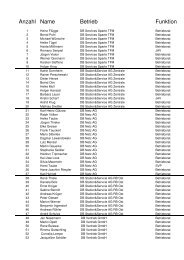Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
AG und die jeweiligen Bundesregierungen<br />
unter dem Kanzler Gerhard Schröder<br />
beziehungsweise unter der Kanzlerin<br />
Angela Merkel mit aller Macht den<br />
<strong>Bahn</strong>börsengang vorantrieben. Das erfolgte<br />
in den Jahren 2003 bis 2008. Bereits<br />
2005 war der Zusammenhang zwischen<br />
dem Börsengang und der S-<strong>Bahn</strong>-<br />
Krise erkennbar – siehe den Kasten auf<br />
Seite 8 zur Kampagne des damaligen S-<br />
<strong>Bahn</strong>-Betriebsrates. Allerdings war der<br />
S-<strong>Bahn</strong>-Betriebsrat damals ein einsamer<br />
Rufer in der Wüste – ebenso wie das zu<br />
diesem Zeitpunkt neu gegründete Bündnis<br />
<strong>Bahn</strong> für Alle. Noch im Mai 2008<br />
fasste der Deutsche Bundestag einen bis<br />
heute relevanten Beschluss, wonach so<br />
bald als möglich die neu gebildete Subholding<br />
des DB Konzerns, die DB ML AG,<br />
bis zu 24,9 Prozent an private Investoren<br />
verkauft werden sollte. Da bei DB ML der<br />
Schienenfernverkehr (DB Fernverkehr),<br />
der Schienennahverkehr einschließlich<br />
der S-<strong>Bahn</strong>en (DB Regio), der Schienengüterverkehr<br />
(DB Schenker Railion) und<br />
die internationalen Aktivitäten des<br />
<strong>Bahn</strong>konzerns (Schenker und Arriva) gebündelt<br />
sind, orientiert dieser bis heute<br />
gültige Beschluss des Bundestags auf die<br />
Teilprivatisierung des gesamten Schienenverkehrs.<br />
Es war Peter Ramsauer, der<br />
damalige Vorsitzender der CSU-Landesgruppe<br />
im Deutschen Bundestag, der<br />
sich in besonderer Weise für diesen Bundestagsbeschluss<br />
und für einen <strong>Bahn</strong>börsengang<br />
engagierte.<br />
Derselbe Peter Ramsauer formulierte<br />
dann auf dem Höhepunkt der S-<strong>Bahn</strong>-<br />
Krise in <strong>Berlin</strong>, als eine Kritik am <strong>Bahn</strong>börsengang<br />
opportun geworden war,<br />
zutreffend wie folgt: „Um die hohen<br />
Renditeforderungen des Mutterkonzerns<br />
DB zu erfüllen, haben die dienstbeflissenen<br />
S-<strong>Bahn</strong>-Manager ihren Laden ausgepresst<br />
wie eine Zitrone – auf Kosten<br />
der Sicherheit und des Services.“ 6<br />
Wobei es natürlich nicht primär die<br />
„S-<strong>Bahn</strong>-Manager“, sondern die Top-<br />
Manager der Konzernspitze waren, die<br />
diese Politik betrieben hatten – unterstützt<br />
durch die jeweiligen Bundesregierungen<br />
und Herrn Ramsauer selbst.<br />
<strong>Berlin</strong> ist eine Stadt, in der auch heute<br />
noch die Hälfte der Haushalte über<br />
kein Auto verfügt. Damit dürften rund<br />
40 Prozent der Menschen im führerscheinbefähigten<br />
Alter, also der Erwach-<br />
Lunapark21·extra 6/2012<br />
senen, kein Auto haben. Rechnet man<br />
auch die Menschen im Alter von sechs<br />
bis 17 Jahren mit ein, dann dürfte in<br />
<strong>Berlin</strong> tatsächlich rund die Hälfte der<br />
Menschen, für die Mobilität ein hohes<br />
Gut ist, nicht über einen Pkw zur Bewältigung<br />
ihrer Alltagsmobilität verfügen.<br />
Diese Menschen sind auf ihre Füße, auf<br />
Fahrradpedale und auf die öffentlichen<br />
Verkehrsmittel angewiesen. Es gibt in<br />
Deutschland keine andere Stadt, in der<br />
es derart günstige Bedingungen für eine<br />
zukunftsfähige Verkehrspolitik geben<br />
würde.<br />
Die bisherigen Regierungen auf Bundesebene<br />
und in der Stadt <strong>Berlin</strong> selbst,<br />
erwiesen sich als unfähig, eine solche<br />
zukunftsfähige und notwendige Verkehrs-<br />
und <strong>Bahn</strong>politik umzusetzen.<br />
Offensichtlich wird eine solche dringend<br />
erforderliche Politik der Verkehrswende<br />
S-<strong>Bahn</strong> Desaster<br />
nur dann Erfolg haben, wenn sie von<br />
unten kommt: von den Menschen vor<br />
Ort, von den Beschäftigten im öffentlichen<br />
Verkehr, bei der <strong>Bahn</strong>, unterstützt<br />
von Umweltorganisationen und Verkehrsinitiativen.<br />
Der S-<strong>Bahn</strong>-<strong>Tisch</strong> in <strong>Berlin</strong> und die<br />
Initiative für ein Volksbegehren zum<br />
Erhalt einer fahrgastfreundlichen S-<br />
<strong>Bahn</strong> sind der Versuch, eine Bewegung<br />
von unten und aus der Bevölkerung zur<br />
Rettung der S-<strong>Bahn</strong> <strong>Berlin</strong> zustande zu<br />
bekommen.<br />
Winfried Wolf ist Chefredakteur von<br />
Lunapark21 – Zeitschrift zur Kritik der globalen<br />
Ökonomie und Verfasser mehrerer verkehrswissenschaftlicher<br />
Bücher (u.a. von<br />
„Verkehr. Umwelt. Klima – Die Globalisierung<br />
des Tempowahns“; Köln 2007 und 2009, und<br />
„<strong>Berlin</strong> – Weltstadt ohne Auto. Eine<br />
Verkehrsgeschichte 1848 – 2015“, Köln 1994).<br />
Anmerkungen:<br />
1 Es ist nicht ganz einfach, eine genaue Geburtsstunde der S-<strong>Bahn</strong> zu benennen. 2013 wird<br />
man das hundertjährige Jubiläum des Beschlusses des Preußischen Landtags über das<br />
„Gesetz über die Umstellung der <strong>Berlin</strong>er Stadt-, Ring- und Vorortbahnen auf elektrischen<br />
Betrieb“ aus dem Jahr 1913, eine Art Gründungsgesetz für die S-<strong>Bahn</strong>, begehen können.<br />
1924 wurde der elektrische Regelbetrieb auf dem ersten Streckenabschnitt, auf der<br />
Verbindung Stettiner Vorortbahnhof – Bernau aufgenommen. 1927/28 gab es die „Große<br />
Elektrisierung“ der Stadt-, Ring- und Vorortstrecken; am 11. Juni 1928 fuhren erstmals<br />
elektrische Züge über die Stadtbahn auf der Verbindung Potsdam – Erkner. Das S-<strong>Bahn</strong>-<br />
Symbol – ein weißes „S“ auf grünen Grund – und der Begriff „S-<strong>Bahn</strong>“ wurden am 1.<br />
Dezember 1930 in <strong>Berlin</strong> offiziell eingeführt und später in anderen Städten für vergleichbare<br />
<strong>Bahn</strong>en übernommen. Für was genau das „S“ steht, ist unklar; mal für „Schnell“, dann<br />
für „Stadt“, auch mal für „Stadtschnellbahn“.<br />
2 Torsten Hampel, Die Entgleisung, in: Die Zeit vom 15. April 2010.<br />
3 Die DDR gab 1984 den Betrieb der S-<strong>Bahn</strong> auf Westberliner Gebiet auf, da dieser u.a. aufgrund<br />
von Boykottaufforderungen im Kalten Krieg zunehmend zu einem Verlustgeschäft<br />
geworden war. Am 9. Januar 1984 übernahm die Westberliner BVG den Betrieb des bereits<br />
stark reduzierten S-<strong>Bahn</strong>netzes im Westteil der Stadt. Nach dem Mauerfall engagierten sich<br />
Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren erfolgreich für eine Ausweitung des S-<strong>Bahn</strong>-Verkehrs<br />
und für einen Wiederaufbau des ursprünglichen S-<strong>Bahn</strong>-Netzes. Am 1. Januar 1995 wurde<br />
die S-<strong>Bahn</strong> <strong>Berlin</strong> GmbH als 100-prozentige Tochter der im Jahr zuvor neu gegründeten<br />
Deutschen <strong>Bahn</strong> AG gebildet.<br />
4 Der GG-Artikel lautet: „Der Bund gewährleistet, dass dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere<br />
den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der<br />
Eisenbahnen des Bundes sowie deren Verkehrsangeboten auf diesem Schienennetz, soweit<br />
diese nicht den Personennahverkehr betreffen, Rechnung getragen wird.“ Der Nahverkehr<br />
war aus diesem GG-Gebot nur deshalb herausgenommen worden, weil dieser mit der<br />
<strong>Bahn</strong>reform von 1993/94 zur Ländersache erklärt wurde und im Zusammenhang mit dem<br />
Regionalisierungsgesetz und den ÖPNV-Gesetzen der Länder noch deutlicher den<br />
Zielsetzungen des „Wohls der Allgemeinheit“ und „den Verkehrsbedürfnissen“ verpflichtet<br />
wurde.<br />
5 Diese Ansicht wurde 1992 formuliert, als die „Initiative für eine bessere <strong>Bahn</strong> – fbb“<br />
gegründet wurde, u.a. mit Heiner Monheim, Tine Seebohm und Winfried Wolf. Aus dieser<br />
Initiative, die die <strong>Bahn</strong>reform und die <strong>Bahn</strong>privatisierung kritisierte, entstand bald darauf<br />
das „Manifest der 1435 Worte“ und schließlich 2001 die <strong>Bahn</strong>fachleutegruppe „Bürgerbahn<br />
statt Börsenbahn – BsB“, die wiederum 2005 zusammen mit Attac, Robin Wood und „<strong>Bahn</strong><br />
von unten“ (in Transnet, heute EVG) den Kern des Bündnisses „<strong>Bahn</strong> für Alle – BfA“ bildeten.<br />
Siehe die Vorworte.<br />
6 In: <strong>Berlin</strong>er Zeitung vom 4.November 2011.<br />
9