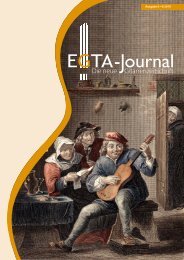EGTA-Journal 11-2018
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Carlo Domeniconi<br />
Rodrigo gehört und es war ein unglaublicher<br />
Krampf. Derjenige, der gespielt<br />
hat, war technisch unglaublich brillant,<br />
doch es sind trotzdem genügend Fehler<br />
passiert. Diesen Krampf kann man<br />
nur dann vermeiden, wenn man Musik<br />
spielt, die wirklich für die Gitarre konzipiert<br />
ist. Rodrigo ist zwar ein guter Komponist,<br />
hat aber von der Gitarre keine<br />
Ahnung gehabt und deshalb ist seine<br />
Originalversion unspielbar.<br />
Diese wurde in diesem speziellen Fall<br />
von Andrés Segovia bearbeitet, damit<br />
sie sich der Gitarre anpasst. Das aber nur<br />
nach seinem persönlichem Geschmack.<br />
Also suchen wir nicht das MÖGLICHE,<br />
sondern das IDIOMATISCHE, das heißt,<br />
dass man in der Sprache des Instrumentes<br />
spricht.<br />
Das stimmt. Man müht sich oft<br />
mit Problemen, die man gar<br />
nicht hätte bei besserer Kenntnis<br />
der instrumentalen Idiomatik.<br />
Das ist auch, was du bspw. schon in einem<br />
Artikel erwähnt hattest, das eigentliche<br />
Dilemma der Gitarre in der Hinsicht,<br />
dass sie sich seit mehr als 100 Jahren<br />
in Kleidern präsentiert, die ihr nicht<br />
wirklich passen und die ihr nicht<br />
gemäß sind. Das hat zwar einerseits<br />
zur Renaissance<br />
der Gitarre durch Segovia<br />
beigetragen, andererseits<br />
war das eigentlich<br />
eine „falsche“ Renaissance.<br />
Segovia hat<br />
sicherlich gewusst,<br />
wie die Gitarre klingen<br />
muss, damit sie<br />
und er erfolgreich<br />
sind. Auf der anderen<br />
Seite sind seine<br />
Einrichtungen nicht<br />
immer ganz glücklich. Und trotzdem hat<br />
er fast nur Komponisten beauftragt, für<br />
Gitarre zu schreiben, die selbst das Instrument<br />
nicht spielen konnten und mit<br />
diesem Repertoire sind wir heute als Interpreten<br />
immer noch konfrontiert. Der<br />
Kanon von Segovia und seinen Schülern,<br />
die diesen vielleicht manchmal auch unreflektiert<br />
weitergetragen haben, ist ja<br />
immer noch verbindlich. Und vielleicht<br />
wäre es wirklich einmal gut, wie du es<br />
einmal gesagt hast, dass man die gitarristische<br />
Szene eine Zeit lang „aussetzte“,<br />
damit das Instrument wieder zu<br />
sich kommt. So wie Kagel sagte, man<br />
müsse Beethoven ein paar Jahre nicht<br />
hören, um ihn dann wieder „richtig“ zu<br />
hören und zu bemerken, was darin für<br />
unglaubliche Kraft steckt. Wenn man<br />
immer zugedudelt wird, dann bemerkt<br />
man das womöglich gar nicht mehr, und<br />
so müsste es eigentlich auch mit der Gitarre<br />
sein. Verstehe ich dich da richtig, du<br />
versuchst eigentlich, die „Seele“ der Gitarre<br />
freizulegen, damit sie so sprechen<br />
kann, wie es ihr gemäß ist und sie im<br />
rechten Licht scheinen kann.<br />
Ja, so kann man es sagen. Und das - wie<br />
von vielen Leuten befürchtet - sei banales,<br />
idiomatisches Komponieren. Es gibt<br />
immer wieder Kompositionen, bei denen<br />
eigentlich nur so ein Griffgeschiebe<br />
vorliegt. Natürlich kann man das gut<br />
und schlecht machen, z. B. bei Villa-Lobos<br />
kommt es oft vor. Ich denke an die<br />
berühmte erste Etüde mit diesem Akkord,<br />
der in jeden Bund passt. Wer jemals<br />
dieses Stück spielt, mag es. Es hat sehr<br />
viel mit Wasser zu tun und dieser Griff<br />
klingt tatsächlich in jedem Bund. Jetzt<br />
kannst du mir aber nicht erzählen, dass<br />
der Komponist diese Töne in dieser Reihenfolge<br />
gehört hat. Siehst du, wo der<br />
Unterschied ist?<br />
Ja, das kommt vom Instrument.<br />
Ja, vom Instrument. Es ist ein Griff,<br />
es ist ein Akkord, der einfach nur<br />
zerlegt wird. Das würde aus der Sicht z.B.<br />
eines Pianisten, unmöglich sein, es so zu<br />
hören. Die Reihenfolge dieser Töne bestimmt<br />
in diesem Fall nicht der Komponist,<br />
sondern das Instrument.<br />
Der Komponist aber sucht nach einem<br />
Griff, der – wenn wir wieder dieselbe<br />
Etüde nehmen – in jeder Lage gut klingt.<br />
Dabei sind nicht die Intervallverhältnisse<br />
wichtig, sondern die Spannung, die sich<br />
aus den jeweiligen Positionen ergibt.<br />
Einen Unterschied könnte man darin sehen,<br />
dass man in einem Fall vertikal (also<br />
wie die Töne übereinander klingen) oder<br />
im anderen Fall horizontal (wie der Klang<br />
sich nacheinander verändert) hört.<br />
Es ist nicht das normale Hören, das ich<br />
bei einem Musikdiktat brauche. Dabei<br />
muss man sehr analytisch werden. Du<br />
fragst: „Was hörst du jetzt?“ Du hörst ab<br />
diesem Moment nicht die Schritte des<br />
Arpeggios, du hörst sie nicht hintereinander,<br />
sondern nimmst das Arpeggio als<br />
Ganzes wahr.<br />
Was du hörst, ist jedes Mal die Spannung<br />
des Akkordes, die darauf beruht, dass<br />
eben ein Teil der Saiten so bleibt und der<br />
andere sich bewegt.<br />
Das ist über den Intellekt unmöglich zu<br />
erreichen, aber instrumentenkonform<br />
und deshalb idiomatisch.<br />
Ausgabe 5 • <strong>11</strong>/<strong>2018</strong><br />
57