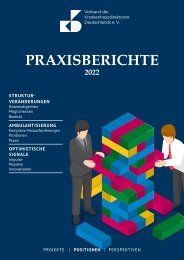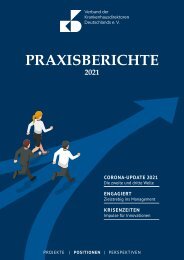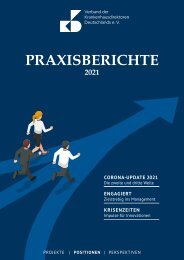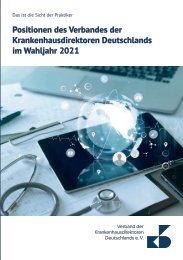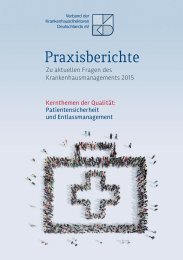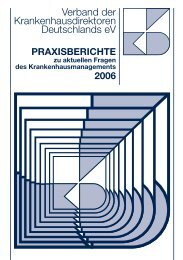VKD-Praxisberichte 2019
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„ PATIENTENSICHERHEIT<br />
Man kann sagen, dass die „Aktion Saubere Hände“<br />
bei den Krankenhäusern inzwischen fast allein läuft.<br />
Große Defizite sehen wir allerdings in den ambulanten<br />
Bereichen, auf die wir uns daher jetzt deutlich stärker<br />
konzentrieren.<br />
“<br />
häusern wurden im vorigen Jahr freiwillig auf 1.907<br />
Stationen direkte Beobachtungen zur Umsetzung<br />
der Händedesinfektion im klinischen Alltag als Instrument<br />
zur Verbesserung der Patientensicherheit<br />
durchgeführt.<br />
Man kann sagen, dass die „Aktion Saubere Hände“<br />
bei den Krankenhäusern inzwischen fast allein<br />
läuft. Große Defizite sehen wir allerdings in den<br />
ambulanten Bereichen, auf die wir uns daher jetzt<br />
deutlich stärker konzentrieren.<br />
Immer neue Themen wurden dann angepackt.<br />
Gab es eine Vorstellung, einen Plan dafür, welche<br />
Themen in welcher Reihenfolge angegangen<br />
werden sollten?<br />
Hedwig François-Kettner: Was die Planung der<br />
einzelnen Themen betrifft, die wir intensiver bearbeiten,<br />
so reagieren wir hier intensiv vor allem auf<br />
Hinweise aus der Praxis und den Fachgesellschaften.<br />
Fast alle kommen also von außen und werden<br />
vor der Bearbeitung daraufhin geprüft, ob eine<br />
entsprechende Handlungsempfehlung der Patientensicherheit<br />
dient. Das ist die einzige Zielsetzung.<br />
Bei allen Handlungsempfehlungen prüfen wir die<br />
Relevanz, schauen, ob es Erfahrungswerte gibt,<br />
führen eine seriöse Literaturrecherche durch und<br />
legen Leitlinien zugrunde, wenn es diese gibt.<br />
Auch bei schwierigen Themen – zum Beispiel die<br />
Gruppe ambulant versorgter intensivpflichtiger Patienten<br />
betreffend – sind wir durchaus unerschrocken,<br />
wenn es der Patientensicherheit dient. Dafür<br />
muss eigentlich jedes Mittel recht sein. Wir unternehmen<br />
das, was andere nicht tun.<br />
Die derzeit insgesamt zehn interdisziplinären und<br />
multiprofessionellen Arbeits- und Expertengruppen<br />
unseres Vereins, an denen sich bis zu 250 ehrenamtliche<br />
Akteure beteiligen, beschäftigen sich<br />
mit einer ganzen Reihe von konkreten Projekten<br />
und beteiligen sich auch an Trainings, die wir anbieten.<br />
Sie arbeiten derzeit u.a. an den Themen<br />
Außerklinische Intensivversorgung (AIV), Arzneimitteltherapiesicherheit,<br />
CIRS im ambulanten Sektor,<br />
Digitalisierung und Patientensicherheit, Medizinprodukte<br />
assoziierte Risiken, Sepsis und weiteren.<br />
Das Spektrum ist weit gefächert.<br />
Die Arbeitsgruppen tagen regelmäßig. Ihre Ergebnisse<br />
werden in Form von Handlungsempfehlungen<br />
– das sind Anleitungen zur Umsetzung von<br />
Sicherheitsstrategien – und zusammen mit Begleitdokumenten<br />
wie Infoflyern und Hintergrundbroschüren,<br />
veröffentlicht. Hinzu kommen Patienteninformationen<br />
und weitere Publikationen, die den<br />
Einrichtungen im Gesundheitswesen, den Patienten<br />
und Angehörigen kostenlos zur Verfügung gestellt<br />
werden.<br />
Woher kommt das Geld dafür – und für die Aktivitäten<br />
des APS?<br />
Hedwig François-Kettner: Das APS finanziert seine<br />
Projekte und Aktivitäten zu einem Drittel aus<br />
Mitgliedsbeiträgen, zu einem weiteren Drittel aus<br />
Spenden und zum letzten Drittel aus Projektfinanzierungen<br />
– insgesamt operiert das Aktionsbündnis<br />
vollständig unabhängig. Es gibt einen entsprechenden<br />
Leitfaden für die Arbeitsgruppen. Bei Veröffentlichungen<br />
erhalten wir Unterstützung. So hat das<br />
Bundesgesundheitsministerium die Handlungsempfehlungen<br />
der vergangenen Jahre in englische<br />
Sprache übersetzen lassen.<br />
Auch die Jahreskonferenzen des APS thematisierten<br />
immer ganz bestimmte Aspekte<br />
der Patientensicherheit. In diesem Jahr<br />
ging es aber nicht um ein solches Fachthema<br />
mit allen seinen Facetten, sondern um<br />
einen ganzheitlichen Ansatz. Es ging um<br />
„Sicherheitskultur auf allen Ebenen“. Aus<br />
der Erfahrung heraus, dass sich doch noch<br />
zu wenige Menschen im Gesundheitswesen<br />
mit dem Thema beschäftigen?<br />
Hedwig François-Kettner: Patientensicherheit<br />
muss Anliegen aller sein, muss im klinischen<br />
und pflegerischen Alltag zur Selbstverständlichkeit<br />
werden. Das beginnt natürlich<br />
schon beim Management. Ehrlich gesagt: Auch aus<br />
meiner eigenen Erfahrung heraus weiß ich, dass sie<br />
dort bereits vielfach nicht den Stellenwert hat, der<br />
ihr zukommen müsste. Es geht uns darum, alle Bereiche<br />
– ambulant wie stationär - einzubeziehen,<br />
also tatsächlich auch um eine prägende Kultur, der<br />
sich alle verpflichtet fühlen.<br />
Bisher haben wir in der Praxis eine separate Betrachtung<br />
der eigenen Handlungsfelder - auch in<br />
den Vorständen. Die Vielfalt muss bereits hier abgebildet<br />
werden, damit<br />
die verschiedenen Perspektiven<br />
eingebracht<br />
werden können.<br />
Wir haben vor allem erreicht, dass<br />
dieses wichtige Thema in allen Bereichen,<br />
in denen Patienten<br />
behandelt und versorgt werden,<br />
einen deutlich höheren Stellenwert<br />
erlangt hat.<br />
„<br />
“<br />
Was die Berufsgruppen<br />
betrifft, so agieren sie<br />
noch immer traditionell<br />
eher nebeneinander.<br />
Separiertes Lernen<br />
aber ist nicht sinnvoll – weder im Vorstand noch<br />
innerhalb der einzelnen Berufsfelder. Wir müssen<br />
die Bedeutung von Teamlernen verstehen, in das<br />
jeder seine Kompetenzen einbringt. Dafür gibt es<br />
bereits Modellprojekte, etwa in der Heidelberger<br />
Universitätsklinik.<br />
Das APS fordert zudem einen speziell für die Patientensicherheit<br />
Beauftragten. Wäre das nicht<br />
eigentlich die Aufgabe des Risikomanagers?<br />
Hedwig François-Ketter: Nein. Es geht hier darum,<br />
sämtliche Strukturen in die Betrachtung einzubeziehen.<br />
Patientensicherheit muss zur Chefsache<br />
werden. Daher muss dann auch die für Patientensicherheit<br />
verantwortliche Person im TOP-Management<br />
verankert sein. Sie hat die Aufgabe, Prozesse<br />
innerhalb des Unternehmens zu bewerten und<br />
PATIENTENSICHERHEIT<br />
dafür zu sorgen, dass sie kontinuierlich im Sinne<br />
der Patientensicherheit verbessert werden sowie<br />
Transparenz nach innen und außen hergestellt<br />
wird. Eine komplexe Aufgabe also. Die Zahl der vermeidbaren<br />
Patientenschäden ist immer noch groß<br />
– trotz allen Engagements.<br />
Die Zahlen scheinen sich in den vergangenen<br />
Jahren tatsächlich nur wenig verändert zu haben.<br />
Rund 800.000 unerwünschte Ereignisse werden<br />
in jedem Jahr angenommen – wie kommt diese<br />
Zahl zustande – und welche Ereignisse stehen<br />
dabei an vorderer Stelle?<br />
Hedwig François-Kettner: Nach wie vor sind Infektionen,<br />
unerwünschte Arzneimittelereignisse,<br />
diagnostische Fehler, wie zu spät erkannte Sepsis,<br />
Dekubitus, Stürze, prioritär ursächlich. Infektionen<br />
insgesamt gehen nicht zurück, aber bei den Nosokomialen<br />
Infektionen erkennen wir eine durchaus<br />
erfreuliche Entwicklung – auch wenn es natürlich<br />
immer noch besser sein könnte.<br />
Die Validität internationaler und nationaler Studien<br />
sowie systematischer Reviews ist heute im<br />
Vergleich zu 2006/ 2008 gut. Serielle Untersuchungen<br />
in den Niederlanden<br />
wie auch geprüfte<br />
Interventionsstudien<br />
zeigen epidemiologische<br />
Ergebnisse, die für<br />
Deutschland als Näherung<br />
beschrieben werden.<br />
Danach liegen unerwünschte<br />
Ereignisse bei fünf bis zehn Prozent – das<br />
sind 400.000 bis 800.000 Fälle. Vermeidbar sind davon<br />
zwei bis vier Prozent, die Behandlungsfehler<br />
machen ein Prozent aus. Vermeidbare Todesfälle<br />
betrafen 20.000 Patienten oder 0,1 Prozent.<br />
Sehen Sie seit Gründung des APS in 2005 Veränderungen<br />
- nicht nur Aktionen in Kliniken und<br />
bei niedergelassenen Ärzten? Wo sehen Sie generell<br />
Verbesserungen?<br />
Hedwig François-Kettner: Wir erheben keine Zahlen.<br />
Daher sind Verbesserungen schwer nachweisbar.<br />
Erfreulicherweise erkennen wir bei den Krankenhäusern<br />
dennoch positive Entwicklungen. Eine<br />
aktuelle Evaluation unserer Handlungsempfehlungen<br />
dokumentiert hier durchaus Fortschritte. Von<br />
769 befragten Krankenhäusern gaben knapp 90<br />
<strong>VKD</strong>-PRAXISBERICHTE <strong>2019</strong> | KAMPF UMS PERSONAL - PATIENTENSICHERHEIT 58<br />
59<br />
<strong>VKD</strong>-PRAXISBERICHTE <strong>2019</strong> | KAMPF UMS PERSONAL - PATIENTENSICHERHEIT