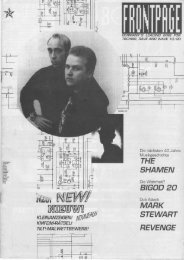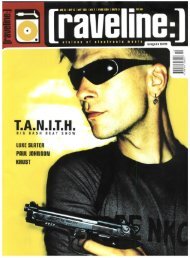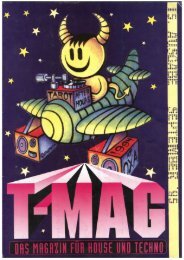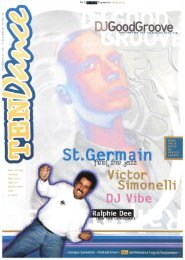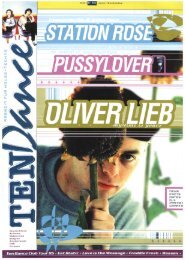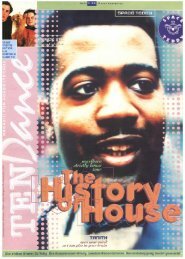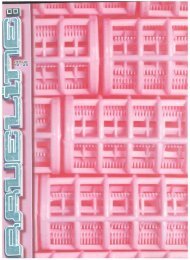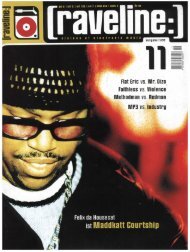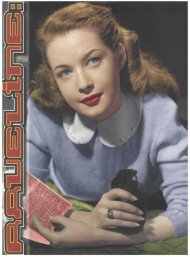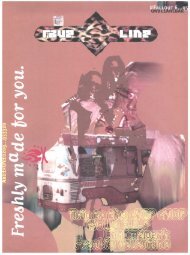De_Bug (Germany) 055 2002-01
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
buch
Neue Bücher
Derrida als Buch
Nicht nur wegen des Adorno-Preises
hat Derrida derzeit Hochkonjunktur.
Pünktlich zum diskursiven Höhenflug
hat Suhrkamp die lesenswerte Einführung
in das Derrida'sche Denken
von Geoffrey Bennington wieder aufgelegt,
die gleichzeitig eine Biographieannäherung
ist und noch einen
kommentierenden literarischen Text
von Derrida vorweisen kann. Für alle
Anfänger, Privatleben-Naseweise und
ansonsten neugierig Gebliebenen.
[Mercedes Bunz]
Jacques Derrida. Ein Porträt von Geoffrey
Bennington und Jacques Derrida. Frankfurt am
Main, Suhrkamp stw, EUR 14
Pflichtlektüre
für Parlamentarier
Derrida hielt 1996 die beiden Seminare,
die hier als "Von der Gastfreundschaft"
(De L'Hospitalité) im Passagen
Verlag mit einem schönen langen
Nachwort namens "Einladung" von
Anne Dufourmontelle erscheinen.
Es groovt sich über eine Textanalyse
von Stellen Platons (Sophistes) und
Sophokles (Ödipus) ein und landet
(für Leser von "La Carte Postale"
nicht…) ganz unerwartet bei einer
etwas anderen Kritik der Überwachung
von Telekommunikation, in
Sätzen wie diesem: "Doch die gegenwärtige
Technikentwicklung strukturiert den Raum
in der Weise neu, dass gerade das, was einen
kontrollierten und genau umschriebenen Raum
des Eigentums konstituiert, diesen für Eindringlinge
öffnet. Auch das ist nichts völlig
Neues: Um den Raum eines bewohnbaren
Hauses und eines Zuhauses zu schaffen,
braucht es auch eine Öffnung, eine Tür und
Fenster, man muss dem Fremden einen Durchgang
anbieten". Woraus er, nicht unlustig
und nicht nur die Gastfreundschaft
untrennbar mit der Möglichkeit
des Gesetzes überhaupt verbindet,
sondern vor allem ((aber)) Asylrecht
und digitale Freiheit als untrennbar
zusammengehörig kurzschließt
und als nahezu kantische Pflicht
Europas zum ewigen Frieden bezeichnet.
Eine Pflichtlektüre also für
jeden Parlamentarier und Innenminister
- insbesondere auch, wenn’s
weil’s mit der etwas dunkel formulierten
Forderung endet, alle
Bemühungen für Afghanistan an der
Verbesserung der Situation der Frauen
zu messen. Gebt euch einen Ruck,
das Buch passt auch definitiv mit seinem
blassgrauen Schutzumschlag
perfekt zwischen Anzug und graues
Haar. [Sascha Kösch]
Jacques Derrida, Von der Gastfreundschaft,
Wien, Passagen Verlag 2001, EUR 20,04
Derrida
und die Universität
Dass Derridas Glaubensbekenntnis
zur Universität nicht nur weit in die
Zwischenräume einer Konstellation
aus Professur, Professionalität, Arbeit,
seinem gespenstischen Marxismus
und damit seiner ungebrochenen
Begeisterung für Austins Unterscheidung
zwischen performativen
und konstativen Akten, die für ihn das
Ereignis der Humanwissenschaften
des 20ten Jahrhunderts darstellen,
einsickern würde, war klar. Dass daraus
eine dislozierte Universität werden
würde, nicht unbedingt. "Die unbedingte
Universität" widmet sich vor allem
der Universität als dem Ort der
Möglichkeit der Frage. Dass man sich
mit Derrida auf einmal wohl fühlen
kann in dieser genau bestimmten
Unbestimmbarkeit, der mehr als realen
Virtualität - ob man Student ist
oder auch nicht Student - vor allem
aber bedingungslos Theorie betreibt,
in ständiger Offensive gegenüber der
Souveränität auch des Wissens, das
nimmt man für einen Preis unter
dem einer handelsüblichen 12"
(14,90 DM) irgendwie gerne mit.
[Sascha Kösch]
Jacques Derrida, Die unbedingte Universität,
Edition Suhrkamp, EUR 7,62
Die Ökonomie
der New Economy
"Es ist einfach nicht mehr cool, etwas herzustellen."
schrieb 1999 der Management-Berater
Ron Nicols. Dass irgendwann
in den 90er Jahren die
Wirtschaft sensibel, jugendlich,
soulful wurde, tanzen lernte, war
auch De:Bug zu entnehmen. Mit
dem neoliberalen Diskurskolonialismus
gegenüber Kultur und auch Politik
befasst sich Thomas Franks neues
Buch mit dem blöd klingenden
deutschen Untertitel "Wider die neoliberale
Schönfärberei". Frank ist kein
Unbekannter: als Herausgeber des
Kulturmagazins "The Baffler" formulierte
er Mitte der 90er Jahre die
Kritik, dass jeder vermeintlich dissidenten
Kultur im Differenzkapitalismus
ihr vermarkteter Platz eingeräumt
wird. Das neue Buch mit dem
Originaltitel "One Market Under God"
rekonstruiert sehr materialreich, wie
der Markt als letzte Verwirklichung
der demokratischen Gesellschaft erfunden
wurde, wie die CEOs großer
Firmen lernten von Revolution zu
sprechen und wie arm sein zur
Schuld wurde. [Alexis Waltz]
Thomas Frank, Das falsche Versprechen der
New Economy. Campus Verlag (Berlin, New
York) 25,46 EURO
Die Guten und Bösen im Netz
Das von Armin Medosch von Telepolis
und Janko Röttgers – u.v.a.
Autor bei uns hier – herausgegebene
Buch "Netzpiraten" will die Subkulturen
des elektronischen Verbrechens
durchforsten und zeigen, dass die
digitalen Grenzen zwischen Innovationen
in digitaler Kultur und Illegalität
vielleicht auch aufgrund oft
nicht geklärter Rechtslagen und
noch viel weniger geklärtem Rechtsund
Besitz-Bewusstseins im Netz
schmaler sind, als einen die Initiativen
der alt bekannten RIAA, MPAA,
der Webbeauftragten und Innenministerien
diverser Staaten, aber vor
allem auch des medial verbreiteten
Bildes von Hackern und anderen
Bösewichten im Netz glauben machen
wollen. In einer Artikelsammlung
von Boris Gröndahl, Christiane
Schulzki-Haddouti, Bernhard
Günther, Florian Schneider, Florian
Rötzer, Peter Mühlbauer, Ralf
Benrath, David McCandless und den
Herausgebern bildet sich so ein
breitgefächerter Kampf um Style,
Überlebensstrategien, Langeweile,
Sicherheitslücken, das Recht auf Informationsfreiheit
und andere Basistendenzen
der digitalen Welt mit
höchst unterschiedlichen Mitteln
und Zielen ab. [Sascha Kösch]
Armin Medosch, Janko Röttgers (Hrsg.):
Netzpiraten. Die Kultur des elektronischen
Verbrechens, Heise/Telepolis 2001, 15 Euro
Pragmatische
Medienphilosophie
Mike Sandbothe setzt modisch adrett
gekleidet zur Denkerpose ein freundliches
Gesicht auf und so könnte man
auch seine Philosophie charakterisieren.
Mit seiner Habilitationsschrift
"Pragmatische Medienphilosophie. Grundlegungen
einer neuen Disziplin" verankert er
das Denken um die Medien ein weiteres
Mal im Haus der Philosphie.
Schon seit längerem versuchen verschiedene
Medientheorien, sich auf
Dauer als eine Leitdisziplin der Philosophie
einzurichten, bislang zumeist
in der Tradition der Sprachphilosophie
mit dem Argument, dass alles, was
wir sagen, handeln und denken immer
medial vermittelt ist. Doch von Sybille
Krämer, Martin Seel und anderen
Medien-Post-Sprach-Philsophen
grenzt sich Sandbothe explizit ab,
wenn er auch freundlich und befreundet
dabei herüberwinkt. Sandbothes
Denken ist tief vom amerikanischen
Pragmatismus geprägt, vor allem von
Richard Rortry, der die gesamten 241
geschriebene Seiten hindurch als Vaterfigur
aus dem Buch blinzelt, auch
wenn Sandbothe ihm, wie einem wirklichen
Vater eben auch, nicht alles
glaubt - das wäre ja auch noch schöner.
Um gemäß Rorty die Philosophie in
den Dienst der Demokratie zu stellen -
jawohl, analysiert Sandbothe im ersten
Teil Kants pragmatische Ader und erarbeitet
von dort seine Linie der Philosophiegeschichte.
In einem zweiten
Teil konkretisiert er seine pragmatischen
Ansatz an u.a. Derridas Schriftkonzept
als Medienkritik und Wolfgang
Welschs "transversale Vernunft". Und
in einem dritten Teil wendet er sich
mit dieser pragmatisch erarbeiteten
pragmatischen Medienphilosophie
dem Netz zu. Die Richtung, nicht nur
vom Internet neue Impulse für die
Theorie zu erwarten, sondern auch
umgedreht danach zu fragen, ob nicht
die Theorie etwas für das Internet tun
kann, klingt vielversprechend, die Ziele
allerdings muten eher - Verzeihung
- als schwammige Grundwerte an, denen
bohrlochtief zu misstrauen ist. Eine
neue Bewegung zur "pragmatischen
Humanisierung und intelligenten Demokratisierung
des Kapitalismus"? Während der philosophische
Teil einen fundierten
Überblick mit Rortybrille bietet, sackt
die praktische Annäherung an die
Technologie ab, weil sie in der politischen
und technischen Praxis ihre Reflexion
der Begrifflichkeiten aufgibt.
Doch. [Mercedes Bunz]
Mike Sandbothe: Pragmatische Medienphilosophie.
Grundlegung einer neuen Disziplin im
Zeitalter des Internet. Weilerswist, Velbrück
Wissenschaft 2001. 25,05 Euro
Subjekte hören Radio
Dieses Buch ist eine Studie, die Foucaults
Archäologie des Subjektes weiter
treibt und detaillliert an Radio
und Psychotechnik durchspielt, den
zwei Erscheingungsformen von Beginn
des letzten Jahrhunderts. Dominik
Schrage untersucht, auf welche
Weise sich die Formation "Subjekt"
mit dem Siegeszug des Radios und
dem der Psychotechnik bildet und interagiert.
Beides sind typische Techniken,
die in den 20er Jahren populär
gewesen sind und den Menschen,
wenn man das mal so sagen
darf, herausforderten, sich neu zu definieren.
Während die Psychotechnik
die Individualität testete, erlaubte das
Radio, subjektives Erleben kollektiv
hervorzurufen. Wichtig ist die Studie
nicht nur deshalb, weil sie profund
geschrieben ist, sondern vor allem,
weil dieses historische Wissen darum,
wie Technik und Subjekt sich aufeinander
beziehen, angesichts des PC
und des Internets, die zusammen einen
guten Teil Zeit erobert haben, einen
wappnet. Wappnet für die Frage
danach, wie wir uns durch das Internet
verändern oder wie das Netz an
uns andockt. Und einen wappnet für
die umgedrehte Frage. Die, wer das
ist, dieses Uns, denn, wie Monsieur
Derrida gerne schelmisch einwirft:
Noch nie ist jemand einem "Wir" im
Wald begegnet. Das mag stimmen.
Für andere Erlebnisse Zuschriften an:
debug Verlags GmbH, Stichwort: Das
Wir im Wald, Brunnenstr. 196, 10119
Berlin. [Mercedes Bunz]
Dominik Schrage: Psychotechnik und Radiophonie.
Subjektkonstruktionen in artifiziellen
Wirklichkeiten 1918-1932. München, Wilhelm
Fink Verlag 2001, EUR 34,76
Künstliches Leben
Noch bis in die Achtziger wurde die
"Künstliche Intelligenz"-Debatte
mit großer Leidenschaft geführt. Mit
dem PC und dem Internet ist die
Technologie vertrauter geworden
und die Angst vor den Maschinen
hat sich verschoben, vielleicht sogar
verringert, denn schließlich hat jetzt
jeder eine künstliche Intelligenz am
Arbeitsplatz oder sogar zu Hause.
Um so überraschender ist, dass Olaf
Kaltenborn mit dem etwas pathetisch
klingenden Titel "Das Künstliche
Leben. Die Grundlagen der Dritten Kultur"
eine sehr interessante und aktuelle
Studie zur KI vorgelegt hat. Vielleicht
gerade, weil Kaltenborn Politikwissenschaftler
ist und nicht Philosoph,
gelingt es ihm in seiner Dissertation
über die klassische Leib-
Seele-Debatte hindurch und darüber
hinaus zu steigen, hinaus zu dem
produktiven Ansatz, die KI als
Machttechnik zu untersuchen. Auffallend:
auch in dieser Arbeit kommt
an Foucault keiner vorbei. [Mercedes
Bunz]
Olaf Kaltenborn: Das Künstliche Leben. Die
Grundlagen der Dritten Kultur. München,
Fink 2001, EUR 34,77