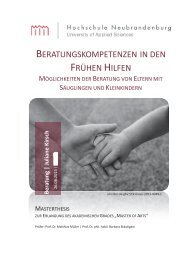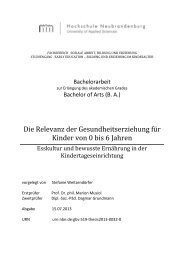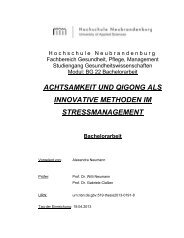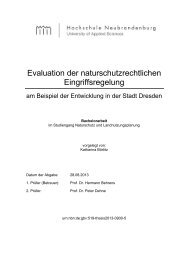Masterarbeit (Anhang)
Masterarbeit (Anhang)
Masterarbeit (Anhang)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
hilfreich wenn der Klient versteht, was bei intensiven Gefühlen in seinem Kopf passiert. Denn<br />
wenn ein starkes Gefühl (z.B. Angst) sich im Körper breit macht, dann können wir es nicht<br />
sofort regulieren, da Stresshormone (z.B. Cortisol) es erschweren, das der präfrontale Cortex<br />
zur Amygdala, dem Gehirnbereich der für die Gefühlsentstehung zuständig ist durchsteuern<br />
kann. Da Gefühle jedoch nie lange anhalten (Signalfunktion: „Ein Signal, das dauernd an wäre,<br />
hätte keinen Signalcharakter mehr“ 242 ), muss man sie über einen bestimmten Zeitraum<br />
einfach akzeptieren und tolerieren, bis sie von alleine nachlassen. Versucht der Klient sein<br />
Gefühl frühzeitig zu regulieren, setzt er sich emotional unter Druck, wodurch der vorprogrammierte<br />
Misserfolg ein Gefühl der Hilflosigkeit erzeugt und die Stressreaktion in der<br />
Amygdala weiter verstärkt und der Klient sich dadurch in seine Gefühle hineinsteigert. Dies<br />
muss der Klient in der Beratung erfahren, um diese Vorgänge begreifen zu können. Zu einer<br />
bewussten Wahrnehmung seines Gefühls kann der Berater den Klienten auf einer Skala von 1<br />
bis 10 (wobei 10 intensiv ist) in kurzen Abständen veranlassen die Intensität des Gefühls einzuschätzen.<br />
Dadurch wird ihm bewusst, dass sein Gefühl nur von relativ kurzer Dauer ist.<br />
Zudem sollte er im Anschluss gemeinsam mit dem Berater erarbeiten was das Gefühl dem<br />
Klienten signalisieren könnte z.B. Schuld; sie motiviert zu ethisch-orientiertem Verhalten.<br />
Dieses Wissen vorausgesetzt befähigt ihn zukünftige Gefühlsausbrüche eher zu akzeptieren<br />
und tolerieren. 243<br />
Um dem Klienten die Wahrnehmung und Deutung seiner Gefühle zu erleichtern, kann er mit<br />
einigen Übungen nach Legenbauer und Vocks (2006) und Akin et al. (2000) seine Gefühlswahrnehmung<br />
aktivieren und verbessern. Dazu kann der Berater zuallererst nach Gefühlen<br />
fragen, die dem Klienten bekannt sind. Akin et al. haben z.B. 184 primäre und sekundäre Gefühle<br />
aufgeführt. 244 Zu Beginn, zur besseren Visualisierung, können die dem Klienten am<br />
geläufigsten Gefühle auf einem Flipchart festgehalten werden. Als nächstes sollten die verschiedenen<br />
erarbeiteten und genannten Gefühle in primäre und sekundäre unterteilt und kate-<br />
gorisiert werden (vgl. Kap. 1.4). 245 Dafür kann das “Gefühlsrad“ (siehe <strong>Anhang</strong>) eine Hilfe<br />
sein. Ihm liegen wissenschaftliche Analysen zur Gefühlsäußerung und Wahrnehmung von<br />
Schmitdt-Atzert und Ströhm (1983) und Ekman (2011) zugrunde. Es enthält die primären<br />
Gefühle wie Freude, Interesse, Ärger, Angst, Traurigkeit, Ekel, Verachtung und sekundäre<br />
Gefühle wie Trauer, Scham, Zuneigung und Neid, welche jeweils als Oberkategorien zur Verfügung<br />
stehen. Andere, wie die exemplarisch vorgegebenen oder selbst empfundenen und<br />
242 Berking 2010, S.96<br />
243 vgl. Berking 2010, S.91ff<br />
244 vgl. Akin et al. 2000, S.38<br />
245 vgl. Legenbauer/Vocks 2006, S.190<br />
� 63�