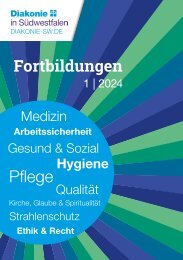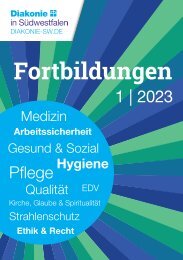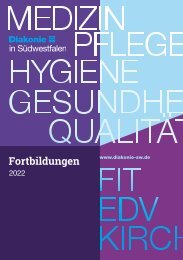Diskurs 3/2022
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ethik<br />
Vom Willen des Patienten<br />
und der Pflicht des Arztes<br />
Patientenverfügung Zwei<br />
Experten beleuchteten im Diakonie<br />
Klinikum Jung-Stilling<br />
ethische und juristische<br />
Grauzonen im Umgang mit<br />
Patientenverfügungen – ein<br />
Thema, das im Krankenhaus-<br />
Alltag immer öfter aufschlägt.<br />
Schicksalsschläge wie Unfälle<br />
oder schwere Erkrankungen<br />
können jeden treffen. Für den<br />
Fall, dass es nicht mehr möglich<br />
ist, selbst über medizinische und pflegerische<br />
Maßnahmen zu entscheiden,<br />
kann eine Patientenverfügung sinnvoll<br />
sein. Doch nicht immer ist damit alles<br />
geklärt – vor allem, wenn der Patientenwille<br />
nur vage hinterlegt ist oder<br />
medizinisch sogar eine positive Prognose<br />
besteht. Mit dieser Problematik<br />
beschäftigte sich ein Vortragsseminar<br />
im voll besetzten Hörsaal des Siegener<br />
Diakonie Klinikums Jung-Stilling. Die<br />
Quintessenz: Der Wunsch des Betroffenen<br />
entbindet den Arzt keineswegs von<br />
seiner Verantwortung. Und aus Patientensicht<br />
ist es ratsam, eine Verfügung<br />
möglichst konkret zu formulieren und<br />
nach gewisser Zeit zu überarbeiten.<br />
Universität Siegen und bis 2021 Mitglied<br />
des Deutschen Ethikrats, sowie<br />
Dr. Wilhelm Wolf, Präsident des Staatsgerichtshofs<br />
Hessen sowie des Landgerichts<br />
Frankfurt.<br />
Ist im Zweifel der Wille des Patienten<br />
oder dessen Lebensschutz höher zu<br />
bewerten? Aus ethischer Sicht verdeutlichte<br />
Philosoph Gethmann, dass der<br />
Mediziner bei dieser Frage stets mit<br />
in der Verantwortung steht: „An der<br />
ärztlichen Abwägung führt kein Weg<br />
vorbei.“ Sobald eine Patientenverfügung<br />
vorliege, bestehe grundsätzlich<br />
erst einmal eine Verpflichtung, diese<br />
zu berücksichtigen. Allerdings gebe es<br />
An der ärztlichen Abwägung<br />
führt kein Weg vorbei.<br />
Prof. Dr. Carl-Friedrich-Gethmann<br />
Dozent für Medizinethik, Uni Siegen<br />
Einschränkungen. Als Beispiel nannte<br />
Gethmann eine Patientenverfügung,<br />
die bereits vor Jahren verfasst wurde<br />
– und damit in Unkenntnis zwischenzeitlicher<br />
Fortschritte in der Medizin.<br />
Auch könnten sich die Präferenzen des<br />
Patienten verändert haben, etwa durch<br />
das eigene Lebensalter oder den Tod<br />
des Lebenspartners. Bedenken könnten<br />
sich auch durch die Art, wie die Verfügung<br />
formuliert ist, ergeben, ebenso bei<br />
Zweifeln an der Entscheidungsfähigkeit<br />
des Patienten. Und auch die Prognostizierbarkeit<br />
des Therapieverlaufs könne<br />
bei der Frage, ob der Verfügung nachzukommen<br />
ist, eine Rolle spielen.<br />
Gethmann ging ferner auf die besondere<br />
Beziehung zwischen Arzt und Patient<br />
ein. Zwar seien die Zeiten vorbei, in denen<br />
der „Doktor“ bevormundend verordnete,<br />
was für den Erkrankten „gut<br />
ist“. Und natürlich habe der Patient das<br />
Recht, therapeutische Maßnahmen abzulehnen.<br />
Dennoch sei dessen Wunsch<br />
keinesfalls die letzte normative Instanz.<br />
„Dadurch würde der Sachverstand des<br />
Arztes komplett relativiert“, betonte<br />
Gethmann. Der Arzt indes stehe in der<br />
Pflicht, seinen Patienten in die bestmögliche<br />
Entscheidungsfähigkeit zu<br />
versetzen. Allerdings werde es immer<br />
Patientenverfügung: „Quasi-Verbot“<br />
für therapeutische Maßnahmen?<br />
Organisiert hatte die Fortbildung für<br />
Ärzte und Pflegekräfte Professor Dr.<br />
Veit Braun, Chefarzt der Neurochirurgie.<br />
Das Thema schlage im Klinikalltag<br />
immer häufiger auf und sorge gerade<br />
unter jüngeren Kollegen für Verunsicherung,<br />
erläuterte er einleitend. Bisweilen<br />
werde eine Patientenverfügung sogar<br />
als „Quasi-Verbot für therapeutische<br />
Maßnahmen“ erachtet – sei es von den<br />
Ärzten selbst oder auch von den Angehörigen.<br />
Aber ist das so? Um Licht<br />
ins Dunkel zu bringen, hatte Braun<br />
zwei hochkarätige Experten eingeladen:<br />
Professor Dr. Carl-Friedrich Gethmann,<br />
Dozent für Medizinethik an der<br />
Lebenswissenschaftlichen Fakultät der<br />
Im Nachgang an eine aufschlussreiche Veranstaltung zum Thema Patientenverfügung im Diakonie<br />
Klinikum Jung-Stilling bedankte sich Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer (links) bei den<br />
Referenten Dr. Wilhelm Wolf (Mitte) und Professor Dr. Carl-Friedrich Gethmann.<br />
68