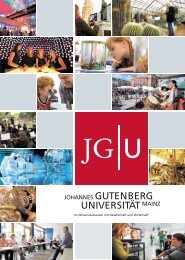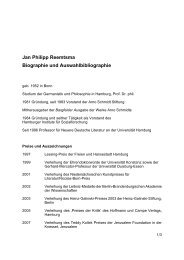Ausgabe 1/2008, 24. Jahrgang (pdf, 6.12 MB - Johannes Gutenberg ...
Ausgabe 1/2008, 24. Jahrgang (pdf, 6.12 MB - Johannes Gutenberg ...
Ausgabe 1/2008, 24. Jahrgang (pdf, 6.12 MB - Johannes Gutenberg ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
SPRACHWISSENSCHAFT<br />
Abb. 2: Umschlag des Wörterbuchs<br />
54<br />
Abb. 3: Beispiel eines<br />
Neologismus aus dem<br />
neuen Wörterbuch.<br />
meinsprache Eingang gefunden haben bzw. tendenziell<br />
auf dem Weg dorthin sein. Das größte Problem<br />
war dabei, wie man den Zeitpunkt des Aufkommens<br />
eines Wortes bestimmen kann. Woher weiß man, ob<br />
ein gefundener datierter Beleg, zum Beispiel in einem<br />
Wörterbuch, die tatsächliche Entstehungszeit dokumentiert?<br />
Und wann tritt der Zeitpunkt ein, wo ein<br />
neu aufgekommenes Wort, ein Okkasionalismus, zum<br />
Allgemeingut, zum Neologismus, wird? Schließlich –<br />
wann verliert ein neues Wort seinen Neuheitscharakter,<br />
wird zur „normalen“ lexikalischen Einheit?<br />
Wenn ein Wort zum ersten Mal in einem allgemeinen<br />
Wörterbuch auftaucht, sprechen einige Autoren<br />
von so genannten lexikografischen oder<br />
Wörterbuch-Neologismen; für andere hört in diesem<br />
Moment der Neologismus auf, ein Neologismus zu<br />
sein. In diesem Sinne wären etwa deutsche Wörter<br />
wie probiotisch, kultig und Cybersex, die nachweislich<br />
in den neunziger Jahren in Gebrauch kamen und<br />
bereits im großen Dudenwörterbuch erfasst sind,<br />
keine Neologismen mehr. Nach unserer Auffassung<br />
behält ein neues Wort, auch wenn es in einem allgemeinen<br />
Wörterbuch bereits verzeichnet ist, noch für<br />
eine Weile seinen Neuheitswert.<br />
Mit derartigen Einordnungsproblemen waren<br />
die Autoren in ihrer Arbeit allenthalben konfrontiert.<br />
Insgesamt wurde durch ein aufwändiges Auswahlverfahren<br />
– Quellen waren neue Wörterbücher,<br />
Frequenzlisten, elektronische Korpora, Pressetexte<br />
und das Internet – ein Korpus von etwa 3.500 neuen<br />
Wörtern, Wortbedeutungen und Wortgruppen<br />
geschaffen, das unserem zeitlichen Kriterium weitgehend<br />
entsprach. Das Material unseres Wörterbuchs<br />
gibt vielfältige Auskünfte über die Veränderungen in<br />
der Lexik, das heißt im Wortschatz beider Sprachen.<br />
Es bestätigt sich, dass sich der Wortschatzzuwachs<br />
vor allem im substantivischen Bereich abspielt. Das<br />
überrascht nicht, denn der Hauptgrund für die Entstehung<br />
neuer Wörter ist die Schließung von Benennungslücken;<br />
sehr oft wird dabei zusammen mit der<br />
Sache auch die neue Benennung übernommen, meist<br />
aus dem Englischen; Beispiele sind body, catering,<br />
curling, label, outsourcing, news, update oder auch<br />
sitcom (Abb. 3). Die Mechanismen zur Bildung neuer<br />
Wörter mit eigensprachlichen Mitteln sind dennoch<br />
weiterhin wirksam und es scheint, als würde sich im<br />
Polnischen öfter als im Deutschen die heimische<br />
Wortbildung gegenüber dem Fremdwort behaupten,<br />
wie die folgenden Beispiele zeigen: ‚Software’ ist im<br />
allgemeinen Sprachgebrauch oprogramowanie, nur<br />
unter Spezialisten funktioniert software. Digitalny<br />
findet man im Polnischen äußerst selten, es wird in<br />
den meisten Verbindungen durch das heimische<br />
cyfrowy ‚Ziffer-’ ersetzt, also heißt es technika cyfrowa<br />
– ‚Digitaltechnik’, cyfryzacja und digitalizacja –<br />
‚Digitalisierung’ bestehen nebeneinander. Andererseits<br />
ist das deutsche Wort ‚Wegfahrsperre’ im<br />
Polnischen immobilizer und das polnische grant steht<br />
für das deutsche ‚Stipendium’.<br />
Der neue Wortschatz spiegelt zugleich die gesellschaftlich-soziale<br />
Situation Polens nach 1989<br />
wider. Und hier gibt es viel Kreativität bei der Versprachlichung<br />
von Konzepten, die den Übersetzer –<br />
auch der Lexikograf ist schließlich in der Position des<br />
Übersetzers – in Bedrängnis bringen. Lexik, die eine<br />
unterschiedliche Akzentsetzung der Sprachträger bei<br />
der Wahrnehmung der Wirklichkeit offenlegt oder<br />
unterschiedliche Phänomene benennt, gibt wenig<br />
Hoffnung auf das Vorhandensein einer lexikalisierten<br />
Entsprechung in der jeweils anderen Sprache. Man<br />
kann in diesen Fällen nur die Bedeutung sehr ausführlich<br />
beschreiben und so dem Übersetzer eine<br />
Hilfestellung bei der Suche nach kontextuellen<br />
Lösungen geben, vgl. blokers (von ‚Block’) –<br />
„Jugendlicher aus den Plattenbau-Wohnsiedlungen,<br />
der sich von der Gesellschaft nicht angenommen<br />
fühlt und deshalb, oft im Verband einer Gang, zu Gewalthandlungen<br />
neigt“, oder dresiarz (wörtlich<br />
‚Dressträger’) – „Vertreter einer aggressiven polnischen<br />
Jugend-Subkultur, oft aus sozial schwachem<br />
Milieu, äußerlich erkennbar am Outfit: Trainingsdress,<br />
Muskelshirt, Goldkettchen u. Ä“. Für das Deutsche<br />
sind in Abhängigkeit vom Kontext mehrere Entsprechungen<br />
denkbar, wie Rowdy, Proll, Assi, Prolet, die<br />
jedoch alle im Unterschied zu dresiarz deutliche stilistische<br />
Unterschiede zeigen.<br />
Neue Wörter schließen aber nicht nur Benennungslücken,<br />
sie bedienen auch als Zweitbenennungen<br />
die expressive Funktion der Sprache. Vor allem<br />
die Jugendsprache ist bekanntlich sehr schöpferisch,<br />
wenn es um die Erneuerung von Wörtern geht, deren<br />
Expressivität sich im alltäglichen Gebrauch abgenutzt<br />
bzw. verschlissen hat. Im Zuge der Demokratisierung<br />
der Sprache gelangen diese Neubildungen<br />
aus Soziolekten, aus dem Substandard und anderen<br />
Varietäten in die Allgemeinsprache. Die deutschen<br />
Adjektive super, spitze(nmäßig), abgefahren, abgedreht,<br />
fett, cool, hammermäßig, (super)geil, krass (wo<br />
es früher klasse, prima, dufte usw. hieß) dokumentieren<br />
diesen Erneuerungsmechanismus anschaulich. Im<br />
Polnischen finden wir czadowy, czaderski, cool, odlotowy,<br />
odjechany, odjazdowy, jazzy, aus dem<br />
Substandard zajebisty. Hier gibt es in beiden<br />
Sprachen sehr viele heimische Bildungen, offensicht-