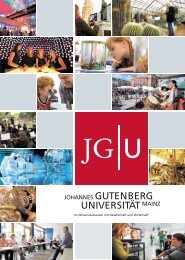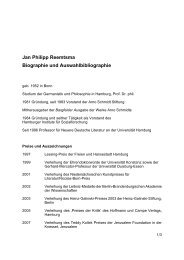Ausgabe 1/2008, 24. Jahrgang (pdf, 6.12 MB - Johannes Gutenberg ...
Ausgabe 1/2008, 24. Jahrgang (pdf, 6.12 MB - Johannes Gutenberg ...
Ausgabe 1/2008, 24. Jahrgang (pdf, 6.12 MB - Johannes Gutenberg ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Auf der Suche nach den fundamentalen Gesetzen der Natur<br />
Von Stefan Tapprogge<br />
„Daß ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält.“<br />
Auch Goethe formulierte in seinem<br />
„Faust“, was immer noch viele Naturwissenschaftler<br />
umtreibt. Das ATLAS-Experiment – ein<br />
Großforschungsprojekt der Teilchenphysik –<br />
versucht Antworten zu finden.<br />
Die Frage nach dem Aufbau der Materie ist eine<br />
Frage, die schon die griechischen Naturphilosophen<br />
wie etwa Demokrit beschäftigte. Die Vorstellung,<br />
dass es kleinste, unteilbare Bausteine gibt, wurde zu<br />
dieser Zeit entwickelt und auch der Begriff „Atom“<br />
(griechisch für unteilbar) geht darauf zurück. Der<br />
Reduktionismus, also das Zurückführen von Phänomenen<br />
auf wenige fundamentale Prinzipien, stellt<br />
einen wesentlichen Ansatz der heutigen Naturwissenschaften<br />
dar, insbesondere in der Physik. Seit dem<br />
19. Jahrhundert ist bekannt, dass Atome eine Struktur<br />
besitzen und somit nicht unteilbar sind. In der<br />
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewannen Teilchenphysiker<br />
daraufhin einen deutlich tieferen Einblick<br />
in die Struktur der Materie. Diese Erkenntnisse<br />
bilden den Inhalt des so genannten Standard-<br />
Modells der Teilchenphysik: Neben einer Anzahl von<br />
fundamentalen Bausteinen (Fermionen: Quarks und<br />
Leptonen) erklärt das Modell die zwischen diesen<br />
Bausteinen wirkenden Kräfte durch den Austausch<br />
von Kraftteilchen (Bosonen). Das Standard-Modell erlaubt<br />
eine erfolgreiche Beschreibung vieler bekannter<br />
Phänomene im Mikrokosmos und ist mit hoher<br />
Präzision getestet worden. Es stellt allerdings keine<br />
vollständige Theorie dar und beinhaltet mehrere offene<br />
Fragen, die Gegenstand der aktuellen Forschung<br />
der Teilchenphysik sind. Insbesondere ergibt sich die<br />
Möglichkeit, durch weitere neue Erkenntnisse zum<br />
Aufbau des Mikrokosmos, mehr über den Aufbau und<br />
die Entwicklung unseres Universums (Makrokosmos)<br />
zu lernen. Eine der aktuellen Fragestellungen betrifft<br />
den Ursprung der Masse der fundamentalen Bausteine<br />
(im Standard-Modell wird hierfür der so genannte<br />
Higgs-Mechanismus angenommen). Ebenso<br />
wird die Frage nach dem Vorhandensein einer Universalkraft<br />
(als gemeinsamer Ursprung der vier bekannten<br />
Kräfte: Gravitation, elektromagnetische, schwache<br />
und starke Kraft) gestellt und auch die Möglichkeit,<br />
dass es neue, bisher nicht entdeckte Teilchen<br />
gibt, wird genauestens überprüft.<br />
Ein wesentliches Werkzeug der Teilchenphysik<br />
stellen Beschleuniger dar, die neben der reinen<br />
Grundlagenforschung mittlerweile auch vielfältige<br />
praktische Anwendungen finden, zum Beispiel in der<br />
medizinischen Therapie und in der Materialüberprüfung.<br />
Durch das Beschleunigen von Teilchen auf hohe<br />
(kinetische) Energien wird es möglich, neue, schwere<br />
Teilchen oder Bindungszustände zu erzeugen und<br />
Strukturen bei kleinsten Abständen (< 10 -18 m) zu<br />
untersuchen. Eines der weltweit Aufsehen erregendsten<br />
Projekte in diesem Zusammenhang ist der Large<br />
Hadron Collider (LHC) am europäischen Zentrum für<br />
Teilchenphysik (CERN) nahe dem schweizerischen<br />
Genf. Nach einer Planungs-, Entwicklungs- und Aufbauphase<br />
von über zehn Jahren wird dieser Beschleuniger<br />
im Sommer <strong>2008</strong> in Betrieb gehen. Er<br />
wird dann der größte, komplexeste und höchstenergetische<br />
Beschleuniger sein, in dem Protonen (Wasserstoffkerne)<br />
miteinander zur Kollision gebracht<br />
werden. Die Energien der Protonenstrahlen betragen<br />
jeweils 7 Tera-Elektronenvolt (TeV). Ein TeV entspricht<br />
10 12 eV bzw. der kinetischen Energie einer Fliege, die<br />
sich mit einer Geschwindigkeit von 10 cm pro Sekunde<br />
bewegt. Die hierbei erzeugten Bedingungen entsprechen<br />
denjenigen, die etwa 10 -14 bis 10 -13 Sekunden<br />
nach dem Urknall im Universum geherrscht<br />
haben. Insgesamt beinhaltet der Beschleuniger rund<br />
300 Billionen Protonen, die auf zweimal rund 2.800<br />
Pakete aufgeteilt sind und fast Lichtgeschwindigkeit<br />
erreichen. Der LHC-Speicherring hat einen Umfang<br />
von fast 27 Kilometern und befindet sich 50 bis 100<br />
Meter tief unter der Erde (Abb. 1). Um die Protonen<br />
bei diesen Energien auf einer Kreisbahn zu halten,<br />
sind über 1.200, je 14 Meter lange, supraleitende<br />
Magnete notwendig, deren Magnetfeld mit 8,3 Tesla<br />
rund 100.000 Mal stärker ist als das Erdmagnetfeld.<br />
FORSCHUNGSMAGAZIN 1/<strong>2008</strong><br />
PHYSIK<br />
Abb. 1: Luftaufnahme der Genfer<br />
Region mit dem Verlauf des unterirdischen<br />
Beschleunigertunnels für<br />
den Large Hadron Collider (LHC).<br />
61<br />
Abb.: © CERN