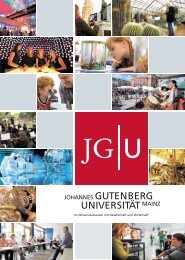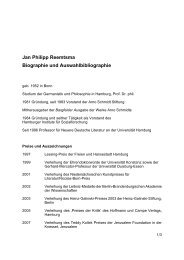Ausgabe 1/2008, 24. Jahrgang (pdf, 6.12 MB - Johannes Gutenberg ...
Ausgabe 1/2008, 24. Jahrgang (pdf, 6.12 MB - Johannes Gutenberg ...
Ausgabe 1/2008, 24. Jahrgang (pdf, 6.12 MB - Johannes Gutenberg ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MEDIEN – FORSCHUNG<br />
Medienkonvergenz, Medienperformanz und Medienreflexion<br />
Von Matthias Bauer<br />
8<br />
Die Medienforschung an der <strong>Johannes</strong> <strong>Gutenberg</strong>-<br />
Universität läuft auf Hochtouren. In einem von<br />
zahlreichen bedeutsamen Medien (ZDF, SWR, 3sat,<br />
HR, FAZ, FR und RMP) geprägten Umfeld richtet<br />
sich die Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf<br />
das Wechselspiel von Medien- und Gesellschaftswandel.<br />
Obwohl ‚die Medien‘ in aller Munde sind, scheint es<br />
weder in der Umgangssprache noch in der wissenschaftlichen<br />
Terminologie einen einheitlichen<br />
Medienbegriff zu geben. Während die einen bei den<br />
Medien vor allem an die Mittel der Massenkommunikation,<br />
insbesondere an das Fernsehen, denken,<br />
sind andere eher an der Wechselwirkung von<br />
Schriftkultur und modernem Bewusstsein interessiert<br />
oder von der virtuellen Welt fasziniert, die im Internet<br />
entsteht. Hinzu kommt der vermeintliche Gegensatz,<br />
der zwischen empirischen Daten und sozialwissenschaftlichen<br />
Methoden einerseits und kulturhistorischen<br />
Interessen und hermeneutischen Verfahren<br />
andererseits besteht. Gleichwohl kann man zwei<br />
Leitmotive ausmachen, die mittlerweile eigentlich<br />
alle Forscherinnen und Forscher umtreiben, die sich<br />
mit der Gestaltung und Nutzung, der Wirkung und<br />
Bedeutung technisch vermittelter Kommunikationsakte<br />
beschäftigen: das Leitmotiv der Medienkonvergenz<br />
und das Leitmotiv der Medienperformanz.<br />
Leitmotiv: Medienkonvergenz<br />
Zum einen geht es um die Digitalisierung praktisch<br />
aller Medieninhalte und -formen, also um die elektronische<br />
Erfassung, Speicherung und tendenziell<br />
weltweite Verbreitung von Texten und Tönen, bewegten<br />
und unbewegten Bildern durch (zunehmend<br />
mobile) Apparate, die multimedial und interaktiv<br />
angelegt und miteinander vernetzt sind. In dieser<br />
Hinsicht kommt die technische Entwicklung, die zur<br />
Medienkonvergenz führt, Marshall McLuhans Vision<br />
von einer Welt, die – elektronisch zusammengezogen<br />
– nur noch ein „global village“ sei (vgl. 1), scheinbar<br />
sehr nahe – nur dass die soziologischen und politischen,<br />
die juristischen und kulturellen, die ethnischen<br />
und ethischen Probleme, die sich aus der Medienkonvergenz<br />
ergeben, eben gerade nicht mehr im<br />
Ältestenrat unter der Dorfeiche gelöst werden können.<br />
Leitmotiv: Medienperformanz<br />
Das Konzept der Medienperformanz geht davon aus,<br />
dass der Umgang mit Hörfunk- und Fernsehprogrammen,<br />
mit Computer-Spielen und Chat-Foren,<br />
blogs und anderen Medienformaten in der Regel<br />
gerade nicht so eingeübt und gelernt wird, wie man<br />
in der Schule über die Grammatik der Sprache oder<br />
das Regelwerk der Mathematik aufgeklärt wird.<br />
Vielmehr wird Medienkompetenz in etwa so aufgebaut,<br />
wie Kinder die Fähigkeit zum Sprechen und<br />
Bezugnehmen, zum Denken und Schlussfolgern<br />
erwerben, also „step by step“ und im Sinne von<br />
„learning by doing“. Es ist alles andere als ein Zufall,<br />
dass die Vollzugsform des Aufbaus mentaler und<br />
kommunikativer Fertigkeiten durchaus an das Prinzip<br />
von „plug and play“ erinnert, muss sich ein Kind<br />
doch in bestimmte Dialoge und Kommunikationssysteme<br />
einschalten (plug) und im Rahmen von mehr<br />
oder weniger komplexen Sprachspielen (play) lernen,<br />
wie man mit Worten und Menschen umgeht, wie<br />
man die Dinge beim Namen nennt und mittels verbaler<br />
oder nonverbaler Äußerungen Handlungen ausführt.<br />
Und eben auf diese Vollzugsform der<br />
Medienpraxis zielt der Begriff der Performanz ab, der<br />
alle Tätigkeiten des Nach- und Mitvollzugs, des Vorführens,<br />
Aufführens und Ausführens umfasst.<br />
Interessant ist, dass der Ausdruck ‚Medienperformanz‘<br />
eine dezidiert interdisziplinäre Genese hat.<br />
In der Sprachwissenschaft sind Kompetenz und<br />
Performanz Komplementärbegriffe. Die Kompetenz<br />
wird im Vollzug erworben, der Vollzug sprachlicher<br />
Handlungen setzt entsprechende Fertigkeiten voraus.<br />
Hatte man zunächst gedacht, dass die Äußerungen,<br />
mit denen man Handlungen vollzieht, eine bestimmte<br />
Sonderklasse von Sprechakten bilden, geht man<br />
heute davon aus, dass jede Kommunikation eine performative<br />
Dimension besitzt. Das wird gerade dort<br />
deutlich, wo man es wie im Theater, in der Literatur<br />
oder im Film mit inszenierten Diskursen zu tun hat.<br />
Freilich erschöpft sich die performative Dimension<br />
der Kommunikation nicht im Vorführen und Zur<br />
Schau Stellen. Vielmehr besteht die grundlegende<br />
Idee der Sprechakttheorie darin, dass man nicht nur<br />
etwas aussagen und die Welt beschreiben, sondern<br />
mittels Sprache tatsächlich Welt erzeugen kann –<br />
zumindest jene Welt der sozialen Tatsachen, in der es<br />
kulturelle Bedeutungen gibt. Diese Welt der sozialen<br />
Tatsachen ist immer eine von Menschen gemachte<br />
Welt, die unter Beobachtung steht. Daher lässt sich<br />
der Begriff der Performanz auch ästhetisch und dra-