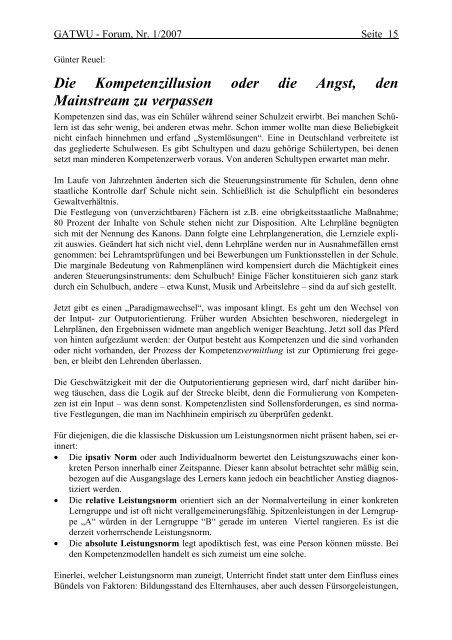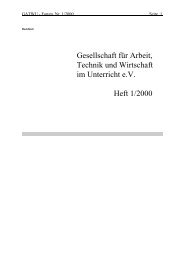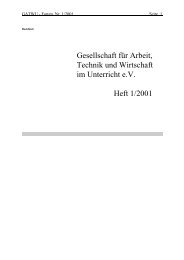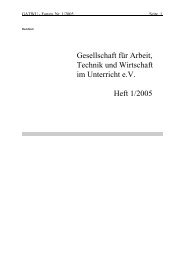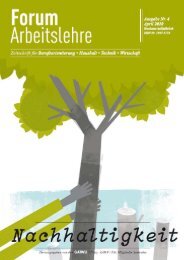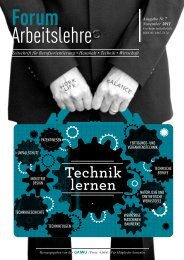Heft 1 /2007
Heft 1 /2007
Heft 1 /2007
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
GATWU - Forum, Nr. 1/<strong>2007</strong> Seite 15<br />
Günter Reuel:<br />
Die Kompetenzillusion oder die Angst, den<br />
Mainstream zu verpassen<br />
Kompetenzen sind das, was ein Schüler während seiner Schulzeit erwirbt. Bei manchen Schülern<br />
ist das sehr wenig, bei anderen etwas mehr. Schon immer wollte man diese Beliebigkeit<br />
nicht einfach hinnehmen und erfand „Systemlösungen“. Eine in Deutschland verbreitete ist<br />
das gegliederte Schulwesen. Es gibt Schultypen und dazu gehörige Schülertypen, bei denen<br />
setzt man minderen Kompetenzerwerb voraus. Von anderen Schultypen erwartet man mehr.<br />
Im Laufe von Jahrzehnten änderten sich die Steuerungsinstrumente für Schulen, denn ohne<br />
staatliche Kontrolle darf Schule nicht sein. Schließlich ist die Schulpflicht ein besonderes<br />
Gewaltverhältnis.<br />
Die Festlegung von (unverzichtbaren) Fächern ist z.B. eine obrigkeitsstaatliche Maßnahme;<br />
80 Prozent der Inhalte von Schule stehen nicht zur Disposition. Alte Lehrpläne begnügten<br />
sich mit der Nennung des Kanons. Dann folgte eine Lehrplangeneration, die Lernziele explizit<br />
auswies. Geändert hat sich nicht viel, denn Lehrpläne werden nur in Ausnahmefällen ernst<br />
genommen: bei Lehramtsprüfungen und bei Bewerbungen um Funktionsstellen in der Schule.<br />
Die marginale Bedeutung von Rahmenplänen wird kompensiert durch die Mächtigkeit eines<br />
anderen Steuerungsinstruments: dem Schulbuch! Einige Fächer konstituieren sich ganz stark<br />
durch ein Schulbuch, andere – etwa Kunst, Musik und Arbeitslehre – sind da auf sich gestellt.<br />
Jetzt gibt es einen „Paradigmawechsel“, was imposant klingt. Es geht um den Wechsel von<br />
der Intput- zur Outputorientierung. Früher wurden Absichten beschworen, niedergelegt in<br />
Lehrplänen, den Ergebnissen widmete man angeblich weniger Beachtung. Jetzt soll das Pferd<br />
von hinten aufgezäumt werden: der Output besteht aus Kompetenzen und die sind vorhanden<br />
oder nicht vorhanden, der Prozess der Kompetenzvermittlung ist zur Optimierung frei gegeben,<br />
er bleibt den Lehrenden überlassen.<br />
Die Geschwätzigkeit mit der die Outputorientierung gepriesen wird, darf nicht darüber hinweg<br />
täuschen, dass die Logik auf der Strecke bleibt, denn die Formulierung von Kompetenzen<br />
ist ein Input – was denn sonst. Kompetenzlisten sind Sollensforderungen, es sind normative<br />
Festlegungen, die man im Nachhinein empirisch zu überprüfen gedenkt.<br />
Für diejenigen, die die klassische Diskussion um Leistungsnormen nicht präsent haben, sei erinnert:<br />
• Die ipsativ Norm oder auch Individualnorm bewertet den Leistungszuwachs einer konkreten<br />
Person innerhalb einer Zeitspanne. Dieser kann absolut betrachtet sehr mäßig sein,<br />
bezogen auf die Ausgangslage des Lerners kann jedoch ein beachtlicher Anstieg diagnostiziert<br />
werden.<br />
• Die relative Leistungsnorm orientiert sich an der Normalverteilung in einer konkreten<br />
Lerngruppe und ist oft nicht verallgemeinerungsfähig. Spitzenleistungen in der Lerngruppe<br />
„A“ würden in der Lerngruppe “B“ gerade im unteren Viertel rangieren. Es ist die<br />
derzeit vorherrschende Leistungsnorm.<br />
• Die absolute Leistungsnorm legt apodiktisch fest, was eine Person können müsste. Bei<br />
den Kompetenzmodellen handelt es sich zumeist um eine solche.<br />
Einerlei, welcher Leistungsnorm man zuneigt, Unterricht findet statt unter dem Einfluss eines<br />
Bündels von Faktoren: Bildungsstand des Elternhauses, aber auch dessen Fürsorgeleistungen,