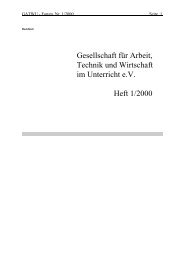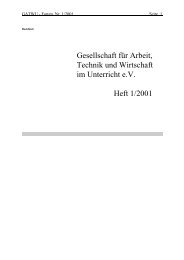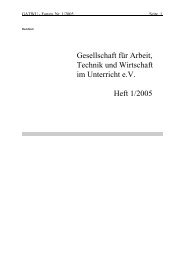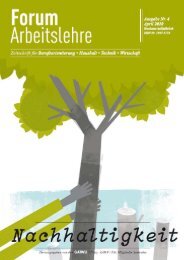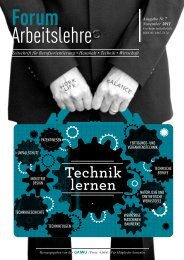Heft 1 /2007
Heft 1 /2007
Heft 1 /2007
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
GATWU - Forum, Nr. 1/<strong>2007</strong> Seite 52<br />
besonders schwer. Während im Jahr 2004<br />
rund 42 Prozent der jungen Frauen in Übergangsmaßnahmen<br />
landeten, waren es bei den<br />
Männern 58 Prozent. Um die Ausbildungsmisere<br />
zu beheben, fordert das Netzwerk<br />
Bildung der Ebert-Stiftung eine Reform von<br />
Schule und Berufsausbildung. Die Schulabbrecherquote<br />
müsse halbiert und der Realschulabschluss<br />
zum "Durchschnittsbildungsniveau"<br />
für die Berufsausbildung werden.<br />
Die rund acht Milliarden Euro, die jährlich<br />
für das Übergangssystem ausgegeben würden,<br />
seien dort besser investiert.<br />
Irle in FR vom 2.2.07<br />
Moment mal! (Gute Arbeit)<br />
Was ist gute Arbeit? Dieser Frage aus der<br />
Sicht von Erwerbstätigen ist eine Gruppe<br />
von Forscherinnen und Forschern Ende 2004<br />
nachgegangen. Nun hat das Internationale<br />
Institut für empirische Sozialökonomie die<br />
Antworten veröffentlicht. Sie bieten einen<br />
repräsentativen Aufschluss über die gewünschte<br />
und tatsächliche Arbeitssituation<br />
in Deutschland.<br />
"Gute Arbeit" ist für abhängig Beschäftigte<br />
mit einem festen, verlässlichen Einkommen<br />
und einem sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz<br />
verbunden. Arbeit soll stolz machen,<br />
abwechslungsreich sein und als sinnvoll<br />
empfunden werden. Ganz wichtig ist, dass<br />
der Vorgesetzte die Beschäftigten in erster<br />
Linie als Menschen und nicht als bloße Arbeitskraft<br />
achtet, dass diese nicht in ein Leistungsrennen<br />
gejagt werden, sondern kollegial<br />
kooperieren. Arbeits- und Gesundheitsschutz<br />
spielt eine ebenso große Rolle wie die<br />
Möglichkeit, Arbeitsmenge und Arbeitstempo<br />
zu beeinflussen und bei der Arbeitsplatzgestaltung<br />
ein Mitspracherecht zu haben. Die<br />
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wünschen,<br />
dass sie ihre Fähigkeiten weiterentwickeln<br />
und verantwortungsvolle Aufgaben<br />
übernehmen. Von ihren unmittelbaren Vorgesetzten<br />
erwarten sie, dass sie für eine gute<br />
Arbeitsplanung sorgen, bei der fachlichen<br />
und beruflichen Entwicklung helfen, Verständnis<br />
für individuelle Probleme aufbringen<br />
sowie anerkennende Worte finden und<br />
konstruktive Kritik üben.<br />
Die abhängig Beschäftigten nennen auch die<br />
positiven Erfahrungen ihrer Arbeitswelt. Mit<br />
Abstand an erster Stelle stehen die Unterstützung<br />
durch Kolleginnen und Kollegen,<br />
die Anerkennung und konstruktive Kritik,<br />
das gute soziale Arbeitsklima. An zweiter<br />
Stelle folgt das Empfinden, ihre Arbeit sei<br />
sinnvoll, deren Güte könne am Arbeitsergebnis<br />
abgelesen werden. Positiv bestätigend<br />
wirkt die soziale und fachliche Unterstützung<br />
durch Vorgesetzte. Allerdings genießt<br />
nur eine Minderheit das Privileg, abwechslungsreich<br />
zu arbeiten, die Arbeitsgestaltung<br />
kreativ zu beeinflussen, die eigenen Kompetenzen<br />
zu entwickeln und sich betrieblich<br />
weiterzubilden.<br />
Unter den subjektiven Belastungen auf der<br />
Gegenseite steht das unzureichende Einkommen<br />
im Brennpunkt. 16 Prozent der<br />
Vollzeitbeschäftigten beziehen ein Bruttomonatseinkommen<br />
von weniger als 1500 Euro,<br />
knapp ein Drittel der Teilzeitbeschäftigten<br />
erhält ein Einkommen von weniger als<br />
400 Euro. Bedrückend ist die Unsicherheit,<br />
den Arbeitsplatz zu verlieren und keine<br />
gleichwertige Stelle zu finden. Schwer belastend<br />
sind körperlich oder extrem einseitig<br />
beanspruchende Arbeiten etwa am Bildschirm,<br />
aber auch komplexe Anforderungen,<br />
wenn mehrere Arbeiten gleichzeitig erledigt<br />
werden sollen, oder wenn hohe Dauerkonzentration<br />
oder eine Arbeit mit geringer Fehlertoleranz<br />
verlangt wird.<br />
Was folgt aus dem überraschenden Ergebnis<br />
der Studie, dass nur drei Prozent der abhängig<br />
Beschäftigten ihre Arbeitssituation insgesamt<br />
als gut einschätzen? Dass zahlreiche<br />
Arbeitssoziologen Modelle konstruieren und<br />
nicht die real existierenden Arbeitswelt beschreiben.<br />
Dass nicht die gut ausgebildeten<br />
und mit demokratischen Lebensformen vertrauten<br />
Belegschaften die Betriebsorganisation<br />
bestimmen. Und dass bei der Aufklärung<br />
von Führungskräften, die den Beitrag<br />
des Arbeitsvermögens zur unternehmeri-