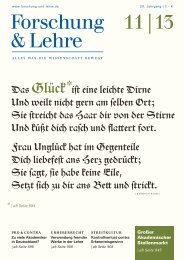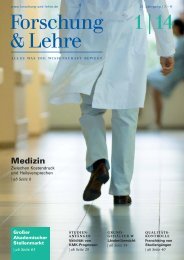Akademischer Stellenmarkt - Forschung & Lehre
Akademischer Stellenmarkt - Forschung & Lehre
Akademischer Stellenmarkt - Forschung & Lehre
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
view<br />
Contra<br />
313<br />
Kritik ist ein Definiens für<br />
Wissenschaft. Peer-Review-<br />
Verfahren sind als Formen<br />
der Kritik anzusehen. In<br />
Kontrast zu den Praktiken privater Marktforschungsfirmen,<br />
die z.B. (in Österreich) ministeriell beauftragt<br />
Hörsaaltüren aufreißen und mit einem Blick<br />
die vorhandene Studentenmasse abschätzen,<br />
oder zu den Artefakten evaluativer Szientometrie<br />
(Stichwort: der umstrittene Impact<br />
Faktor des ISI) sind qualitative Bewertungen<br />
geistiger Leistungen unverzichtbar.<br />
Betont sei der Plural: Das Peer-Review-System<br />
als einheitliches Prüfsystem gibt es<br />
nicht. Zu unterschiedlich sind die Betriebssitten<br />
in einzelnen Disziplinen, Organisationen,<br />
Redaktionen. Die vielen Peer-Review-<br />
Varianten haben unterschiedliche Funktionen:<br />
Bei niedrigen Abweisungsraten (20-30<br />
Prozent in der Physik) sollen Gutachter Aufsätze<br />
zum Druck vorschlagen, es dominieren<br />
serielle Verfahren: Ein Gutachter wird<br />
bestimmt, wenn dieser das Manuskript empfiehlt,<br />
wird es gedruckt; lehnt dieser ab, wird<br />
ein weiterer Gutachter beauftragt. Bei hohen<br />
Abweisungsraten (80-90 Prozent in der Psychologie)<br />
sollen Gutachter Argumente für die<br />
Ablehnung von Manuskripten liefern, es werden<br />
parallele Verfahren (mit 2 bis 4 Gutachtern zugleich)<br />
bevorzugt. Bei diskrepanten Beurteilungen wird das Manuskript<br />
oft abgelehnt.<br />
In der Konkurrenz der Journale fungieren künstlich überhöhte<br />
Abweisungsraten (der Mythos: je höher, desto wissenschaftlich<br />
hochwertiger; manche Journale deklarieren<br />
daher sogar Kürzungsforderungen als Abweisung) und der<br />
„Peer-Review“-Stempel nicht selten als Prestigeschmuck.<br />
Vielfach ist unklar, welche Journale extern begutachtet<br />
werden und welche nicht: Der Vergleich offiziöser Kataloge<br />
bringt nur teilweise Schnittmengen. Oft fehlen jedwede<br />
Angaben zum Begutachtungsverfahren. Manche Herausgeber<br />
behaupten, auf Peer-Review-Basis zu editieren, gewähren<br />
aber großzügige Ausnahmen. Etliche Journale setzten<br />
nach Fehlentscheidungen Peer-Review-Verfahren längere<br />
Zeit wieder ab. So oder so wird nur ein Teil der Beiträge<br />
tatsächlich begutachtet, doch alle Beiträge profitieren<br />
von diesem Nimbus (vgl. den US-Passivraucher-Skandal:<br />
Justitiare eines beklagten US-Tabakkonzerns ließen<br />
unter dem Namen von - dafür honorierten - Top-Medizinwissenschaftlern<br />
Letters an Topjournale unterzeichnen, auf<br />
die sie sich dann vor Gericht erfolgreich berufen konnten).<br />
Pro Kunst- & Contra und<br />
Musikhochschulen<br />
Gerhard Fröhlich,<br />
Dr. phil., Assistenz-<br />
Professor, Universität<br />
Linz<br />
<strong>Forschung</strong> & <strong>Lehre</strong><br />
6/2002<br />
Versagt haben Herausgeber wie Gutachter bei unzähligen<br />
Betrugsaffären; manche waren sogar aktiv involviert.<br />
Viel zu selten untersucht und kritisiert: Die Arkanpraxis der<br />
Herausgeber, die mitunter ihr Journal als diktatorischen<br />
Einmannbetrieb führen. In paradigmenschwachen<br />
Fächern entscheidet die Vergabe<br />
an Gutachter bekannter Schulrichtung<br />
über das Schicksal eines Manuskripts. Etliche<br />
Journale schmücken sich mit großen<br />
Gutachterpools, setzen aber nur einen<br />
Bruchteil davon ein: Einige Oligopolisten fertigen<br />
fast alle Gutachten und beherrschen,<br />
da oft für viele Journalen zugleich tätig, ein<br />
ganzes Feld. Herausgebern wie Gutachtern<br />
vorzuwerfen ist, daß sie die zahllosen<br />
(großteils kritischen) einschlägigen Befunde<br />
der Wissenschaftsforschung nicht kennen<br />
bzw. ignorieren; Gutachter werden nicht geschult.<br />
Einige Reformvorschläge: Dreifachblindbegutachtung<br />
(auch den Herausgebern sollte<br />
die Identität der Autoren vorenthalten<br />
werden - das ist durchaus praktikabel, s.<br />
Zeitschrift für Soziologie, und führt dazu, daß<br />
auch Artikel von Stars abgelehnt werden).<br />
Nach absolviertem Prozeß dessen Offenlegung<br />
inkl. formulierter Kritik, damit alle davon<br />
profitieren können; im Internet wäre dafür Platz genug.<br />
Zufallszuteilung der Gutachter unter Ausschöpfung des<br />
gesamten Pools; bei paradigmenschwachen Fächern nach<br />
Paradigmen geschichtet. Autoren sollten mit dem Risiko<br />
rechnen müssen, zufällig ausgewählt Rohdaten und Labor-<br />
Tagebücher vorzuzeigen, Gutachter zufällig metabegutachtet<br />
zu werden. Die kritischen Befunde der Wissenschaftsforschung<br />
zur Kenntnis nehmen, Konsequenzen ziehen, die<br />
Gutachterkompetenzen systematisch fördern (spätestens in<br />
den Graduiertenkollegs), Gutachter angemessen honorieren.<br />
Zu teuer? Das derzeitige System belohnt die hartnäckig (bei<br />
anderen Journalen) immer wieder Einreichenden (je<br />
„schlechter“ ein Aufsatz, umso mehr professionelle Leser<br />
findet er also). Die Autoren und v.a. die Institutionen, die<br />
mit ihren Evaluationsproblemen den Publikationssektor befrachten,<br />
sollen dafür zahlen. Anm.: Eine statistisch aufwendige<br />
schwedische Untersuchung zeigte im übrigen einen massiv<br />
frauenbenachteiligenden Bias der dortigen Peer Review<br />
Praktiken.