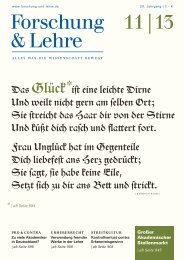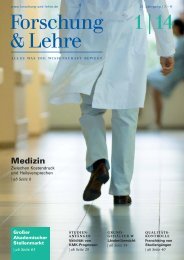Akademischer Stellenmarkt - Forschung & Lehre
Akademischer Stellenmarkt - Forschung & Lehre
Akademischer Stellenmarkt - Forschung & Lehre
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Standvögel<br />
Zahlreiche Vogelarten wie beispielsweise<br />
Amsel oder Mönchsgrasmücke fliegen<br />
in kalten Wintermonaten über Tausende<br />
von Kilometern in wärmere Regionen.<br />
Doch seitdem die Winter erheblich milder<br />
ausfallen als noch vor einigen Jahrzehnten,<br />
ändern die Vögel ihr Verhalten:<br />
Immer mehr bleiben in Mitteleuropa.<br />
Welche Mechanismen dahinterstecken,<br />
hat Professor Peter Berthold von der<br />
Max-Planck-<strong>Forschung</strong>sstelle für Ornithologie<br />
in Radolfzell entschlüsselt. Dafür<br />
wurde der Vogelkundler vom Bodensee<br />
mit dem Philipp-Morris-<strong>Forschung</strong>spreis<br />
ausgezeichnet. Die Mönchsgrasmücke<br />
diente Berthold als <strong>Forschung</strong>sobjekt,<br />
um zu belegen, daß Vögel nicht<br />
nur in der Lage sind, sich veränderten<br />
Umweltbedingungen rasch anzupassen,<br />
sondern dieses veränderte Verhalten<br />
durch eine Veränderung ihrer genetischen<br />
Struktur an die nachfolgenden Generationen<br />
weitergeben. Rund 75 Prozent<br />
aller Mönchsgrasmücken sind Zugvögel:<br />
Sie fliegen im Winter in wärmere<br />
Gefilde, beispielsweise nach Nordafrika.<br />
Rund ein Viertel aller Mönchsgrasmücken<br />
gelten jedoch als so genannte<br />
Standvögel und bleiben selbst in der kalten<br />
Jahreszeit an ihrem Aufenthaltsort.<br />
Doch ob eine neu geborene Mönchsgrasmücke<br />
Zug- oder Standvogel wird,<br />
steckt in den Genen, fand Professor Peter<br />
Berthold heraus: „Wir haben aus den<br />
Vögeln Brutpaare gebildet, also Zugvogel<br />
mit Zugvogel brüten lassen und<br />
Standvogel mit Standvogel. Wir haben<br />
festgestellt, daß sich schon in der ersten<br />
Generation aus den Brutpaaren Standvogel<br />
mit Standvogel der Anteil an<br />
Standvögeln verdoppelt hat und genauso<br />
bei den Zugvögeln.“ Bereits nach drei<br />
weiteren Generationen blieben nur noch<br />
Zug- beziehungsweise Standvögel in einer<br />
der beiden Zuchtlinien über. Für<br />
Berthold war damit klar, daß Erbanlagen<br />
im Zugverhalten eine Rolle spielen,<br />
und daß sich das Verhalten in kürzester<br />
Zeit ändern kann. Veränderungen vom<br />
Zugvogelverhalten hin zum Standvogelverhalten<br />
sieht Berthold als direkte Reaktion<br />
auf geänderte Umweltparameter<br />
an. Durch das wärmere Klima in den<br />
Monaten Januar und Februar besteht für<br />
die Vögel keine Notwendigkeit zum Vogelzug<br />
- eine Information, die sie in wenigen<br />
Generationen durch eine schnelle<br />
genetische Änderung an ihre Nachkommen<br />
weitergeben können.<br />
Quelle: Deutschlandfunk, 17. April 2002<br />
315<br />
Aus Kunst- der <strong>Forschung</strong><br />
und<br />
Musikhochschulen<br />
Gelackt<br />
Kratzfeste Autolacke waren für viele<br />
Autofahrer bisher ein Traum. Auf der<br />
Hannover Messe präsentierten Wissenschaftler<br />
des Leibniz-Instituts für Neue<br />
Materialien (INM) unlängst eine weltweit<br />
zum Patent angemeldete Erfindung<br />
- den ersten superkratzfesten Autolack.<br />
Selbst Stahlwolle kann dem hauchdünnen<br />
Superlack nichts anhaben. Die neuartige<br />
Beschichtung ist nur ein Hundertstel<br />
Millimeter dünn und hat nahezu die<br />
Kratzfestigkeit von mineralischem Glas.<br />
Möglich macht dies eine „Rüstung“ aus<br />
nanoskaligen Keramikpartikeln, die<br />
4000 mal kleiner sind als der Durchmesser<br />
eines menschlichen Haares. Die Erfindung<br />
steht bereits als ausgereifte Pilottechnologie<br />
zur Verfügung. Der Superlack<br />
läßt sich mit den heute in der Automobilindustrie<br />
üblichen Lackierverfahren<br />
verarbeiten.<br />
Quelle: Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried<br />
Wilhelm Leibniz, 30. April 2002<br />
Knappes Wasser<br />
In Musterprojekten versuchen Experten,<br />
die Folgen des Klimawandels und der<br />
Entwicklung auf den Wasserhaushalt zu<br />
prognostizieren. Das Projekt „Global<br />
Water“ (GLOWA) untersucht anhand<br />
von mehreren exemplarischen, überre-<br />
<strong>Forschung</strong> & <strong>Lehre</strong><br />
6/2002<br />
gionalen Wassereinzugsgebieten, wie<br />
Wasserkonflikte entstehen und wie Klimawandel,<br />
wirtschaftliche Entwicklung<br />
und Bevölkerungswachstum darauf Einfluß<br />
nehmen. Professor Wolfram Mauser,<br />
Geograph an der Universität München,<br />
organisierte die GLOWA-Konferenz,<br />
auf der aktuelle Ergebnisse der Teilprojekte<br />
Jordan, Elbe, Donau, Draa/<br />
Oueme in Marokko und Benin sowie<br />
Volta vorgestellt und diskutiert wurden.<br />
Die Konflikte ums Wasser sind alt. So<br />
liegen Israel und Jordanien miteinander<br />
im Streit um das Jordanwasser und zwischen<br />
der Türkei und dem Irak gibt es<br />
seit langem Auseinandersetzungen um<br />
den Euphrat. Der Kampf um das über-<br />
Zugvögel in Formation auf dem Weg in den Süden. Immer mehr Vögel bleiben jedoch<br />
mittlerweile in Mitteleuropa. Foto: dpa<br />
lebenswichtige Wasser werde sich aber<br />
noch verschärfen, angefacht durch Klimawandel,<br />
wirtschaftliche Entwicklung<br />
oder Bevölkerungswachstum. Betroffene<br />
Anrainerstaaten seien Mali, Burkina<br />
Faso, Ghana und die Elfenbeinküste.<br />
Selbst wenn im langjährigen Durchschnitt<br />
künftig nicht weniger Regen fallen<br />
sollte, spekuliert Wolfram Mauser,<br />
würden mit dem Klimawandel die Niederschläge<br />
unregelmäßiger kommen.<br />
Zwangsläufig müßten die Wassernutzer<br />
also künftig mehr Geld in Speichereinrichtungen<br />
investieren. Doch die Mittel<br />
dafür fehlen in diesen Ländern, die ohnehin<br />
am Tropf der Entwicklungshilfe<br />
hängen.<br />
Quelle: Deutschlandfunk, 6. Mai 2002<br />
Meike Krüger