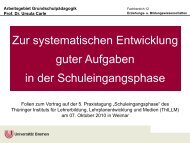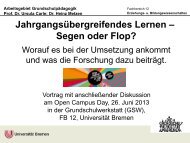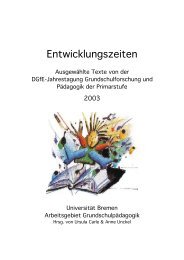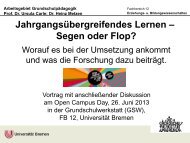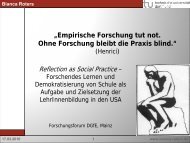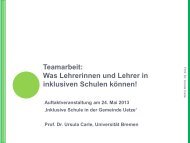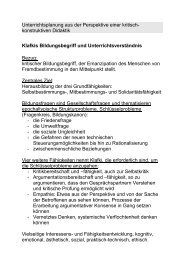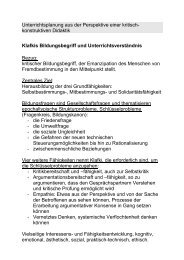Abschlussbericht 2007 - Universität Bremen
Abschlussbericht 2007 - Universität Bremen
Abschlussbericht 2007 - Universität Bremen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Videoanalyse<br />
Der Unterricht – insbesondere in den offenen Unterrichtsformen – macht den Eindruck, dass<br />
die nötigen Strukturen für einen reibungslosen Verlauf noch nicht aufgebaut sind. Folglich<br />
kommt es zu Verzögerungen beim Lernbeginn, zu Staus und zu unharmonischen Verläufen.<br />
Ohne eingeführte Strukturen leidet bei offenem Unterricht ebenso die Effizienz. Der im Modell<br />
der FLEX angelegte Leistungssog kommt nicht in Schwung.<br />
Schon recht gut sichtbare Erfolge zeigen sich in der Lernumgebung. Hier steht bereits Material<br />
für die Kinder zur Verfügung, wenn auch deutlich weniger reichhaltig. Es sind bereits pädagogisch<br />
sinnvolle Abläufe zu sehen, ohne die eine Öffnung gar nicht möglich wäre, die<br />
aber angestrebt wird, wie die eingesetzten Formate des Werkstattunterrichts anzeigen. Dennoch<br />
zeigt sich z. B., dass das Chefsystem noch nicht funktioniert. Auch andere Steuerungselemente<br />
sind sichtbar, Regeln hängen an der Wand, es gibt an der Tafel Hinweise auf den<br />
Wochenplan u. v. a. m.<br />
In der Klasse ist zwar klar, dass Lernbeobachtung erfolgen soll. Die bisherige dient aber viel<br />
mehr der Leistungsbeurteilung als der Vorbereitung einer diagnostisch fundierten Binnendifferenzierung,<br />
die auch noch nicht in das vorhandene System passt. Besonders schwierig in<br />
der aktuellen Situation ist es, dass die Sonderschullehrerin für die Kinder mit Förderbeobachtung<br />
ein eigenes Programm außerhalb des Unterrichts absolviert. Hierbei arbeitet sie sehr<br />
frontal und überwiegend mit traditionellen Aufgaben. Es kommt ihr offensichtlich darauf an,<br />
den Kindern möglichst kleine Häppchen zu verabreichen.<br />
7.5.2 Welche Potenzen und welche Reserven werden offenkundig?<br />
Nehmen wir an, die hier vorgestellten beiden Klassen stellten in etwa das Spektrum der Unterrichtsqualität<br />
von FLEX-Schulen im Land Brandenburg dar, dann ist deutlich, dass die<br />
Potenzen des Modells je nach Entwicklungsstand unterschiedlich aussehen. Schulen, die in<br />
ihrer Entwicklung noch nicht weit gekommen sind, werden es deutlich schwerer haben, die<br />
Aufgabenqualität schnell zu steigern. Entgegen stehen vor allem zu geringe Adaptivität des<br />
Unterrichts, also noch Schwierigkeiten, mit dem unterrichtlichen Setting auf die Kinder so<br />
einzugehen, dass sie individuell gut gefördert werden. Besonders drastisch wird der Entwicklungsbedarf<br />
dann, wenn die Schule schon lange Zeit FLEX-Schule ist und ihre Entwicklung<br />
an den Einstellungen bzw. subjektiven Theorien zentraler Personen scheitert. So ist es kontraproduktiv,<br />
die Kinder mit Förderbeobachtung aus der Klasse zu nehmen. Vielmehr sollten<br />
Möglichkeiten der Binnendifferenzierung und der unterrichtsimmanenten Therapie gefunden<br />
werden, in die andere Kinder mit einbezogen werden können.<br />
Demgegenüber dürften Schulen, die auf der einen Seite des Radardiagramms bereits eine<br />
sehr fortgeschrittene Entwicklung zeigen, kaum Probleme haben, in absehbarer Zeit mit etwas<br />
Unterstützung sogar die Aufgabenqualität anzuheben, also weg von nachvollziehenden<br />
Aufgabenstellungen hin zu stärker problemorientiertem und experimenthaltigem Arbeiten.<br />
220