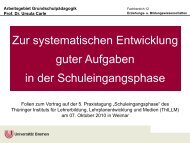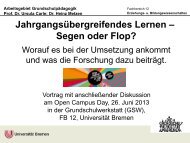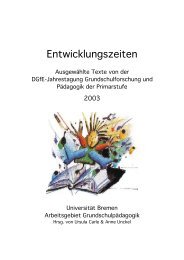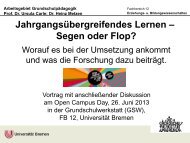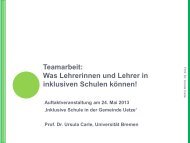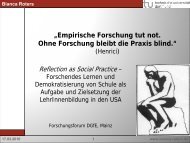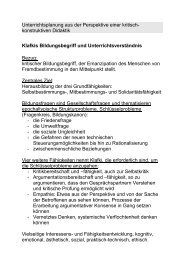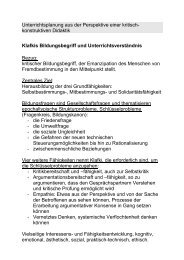Abschlussbericht 2007 - Universität Bremen
Abschlussbericht 2007 - Universität Bremen
Abschlussbericht 2007 - Universität Bremen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Videoanalyse<br />
Allerdings ergibt sich erst im zielorientierten Zusammenspiel aller Faktoren, d. h. die<br />
stimmige Koppelung der Unterrichtsqualitätsaspekte in der jeweiligen Unterrichtspartitur,<br />
guter Unterricht (Carle 2003, 1998). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ziele der Akteure<br />
sich je nach persönlicher Re-Definition der Aufgaben unterscheiden (Carle 1995, 2000). So<br />
kann diese Re-Definition darin bestehen, möglichst viele Aufgaben richtig abarbeiten zu wollen,<br />
oder darin, sich intensiv mit einer Sache auseinanderzusetzen. Ein Kind kann die gestellte<br />
Aufgabe als Auftrag werten, sich daraus eine eigene neue Aufgabe zu formulieren, ein<br />
vorgegebenes Pensum zu erfüllen oder ein sich stellendes Problem zu lösen. Es kann eine<br />
Übung als Gelegenheit zur Vervollkommnung seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten begreifen<br />
oder als Möglichkeit aussehen, einen vorgegebenen Plan abzuarbeiten. Das Kind kann in<br />
der Aufgabe ein ihm bekanntes Unterrichtsformat erkennen, z. B. Werkstattunterricht, und<br />
dieses nach seinem diesbezüglichen Kenntnisstand realisieren.<br />
Exkurs zum Üben<br />
Im jahrgangsgemischten Unterricht der FLEX-Klassen geht es gemäß FLEX-Kriterien wesentlich<br />
um Üben. Die Einführung neuer Inhalte geschieht eher im Jahrgangsunterricht. Es<br />
stellt sich somit die Frage, was eine gute Übung ist (Ausubel 1968, Helmke 2003, 38). Allgemein<br />
sollen Übungsphasen neu erworbene Bedeutungen klären helfen, sie erneut bewusst<br />
machen. Sie dienen außerdem dazu, das neue Wissen in vorhandenes Wissen zu<br />
integrieren, und gewährleisten damit eine Verankerung und Reproduzierbarkeit des erworbenen<br />
Wissens. Weiter sollen die Schülerinnen und Schüler in den Übungsphasen die Möglichkeit<br />
erhalten, Wissen anzuwenden und in neuen Situationen einzusetzen (Transferierbarkeit).<br />
Zugleich dienen Übungen dazu, weitere Basisfertigkeiten, die für die Bewältigung der<br />
Aufgabe benötigt werden, zu verbessern, beispielsweise im Schreiben und Lesen oder im<br />
Einsortieren, in der Gestaltung des Arbeitsplatzes, in der Zeiteinteilung u. v. a. m. Der Lerngewinn<br />
bei Übungen ist am Anfang besonders hoch.<br />
Es wäre ein Fehler, Übungen abzusetzen, wenn der Lerngewinn abnimmt. Besser ist es,<br />
wenn eine Lehrkraft Kinder auch dann noch weiter üben lässt, wenn diese etwas scheinbar<br />
schon recht gut, aber noch nicht sehr sicher beherrschen (Wellenreuther 2005, 139 ff.). Die<br />
Kunst liegt dabei darin, Übungen vom Anforderungsgrad her abzustufen (durch abgestufte<br />
oder offene Aufgaben), sie auf verschiedenen Zielebenen mit Bezug zur Klasse (z. B. lernmethodisch,<br />
fachinhaltlich) und zum einzelnen Kind (z. B. bezogen auf Wahrnehmung, Intuitive<br />
Theorien, Sinnbezug, Volition, Metakognition, Kooperation) so zu gestalten, dass sie zu<br />
einer fortschreitenden Klärung des Gelernten beitragen, zur Transferfähigkeit führen und sich<br />
nicht im Wiederholen auf der Fertigkeitsebene erschöpfen: „Lernen ist ein Prozess, in dem<br />
der Informationsaufnahme ein wiederholtes Bewusstmachen (Erinnern), ein Herstellen von<br />
Verbindungen zu anderen Informationen und ein Anwenden des 'neuen' Wissens folgen<br />
172