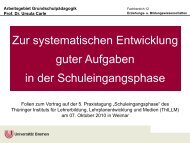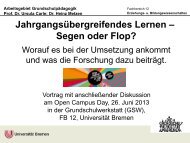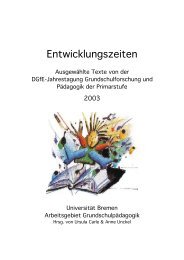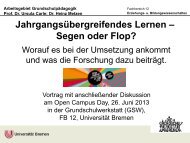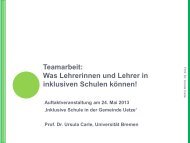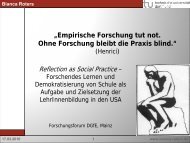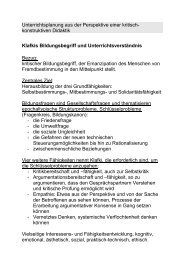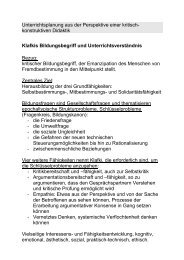Abschlussbericht 2007 - Universität Bremen
Abschlussbericht 2007 - Universität Bremen
Abschlussbericht 2007 - Universität Bremen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Videoanalyse<br />
tenzerwerb zu unterstützen. Weinert (2001, S. 27 f.) versteht mit Rückgriff auf die Expertiseforschung<br />
unter Kompetenzen vor allem kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte<br />
Probleme in variablen Situationen verantwortungsvoll zu lösen und dabei motivationale, volitionale<br />
und soziale Ressourcen einzusetzen. Kompetenzen umfassen somit nicht nur Fähigkeit,<br />
Wissen, Verstehen, Können, Handeln, Erfahrung, Motivation, sondern auch Werthaltung.<br />
Einsiedler (1997a, S. 240) interpretiert Befunde, nach denen problemlösender Unterricht für<br />
den Lernerfolg leistungsstarker und leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler positiv<br />
wirke so: „Man kann diesen Effekt eventuell im Sinne eines kognitiv stimulierenden Klassenkontextes<br />
mit Sogwirkung interpretieren, bei dem die leistungsschwachen Schüler anspruchsvollere<br />
Lösungsmuster erfahren als etwa in Differenzierungsgruppen mit Zuordnung<br />
einfacher Lernaufgaben". Folglich müsste anspruchsvoller, jahrgangsgemischter Unterricht<br />
ebenfalls eine solche Sogwirkung erzeugen. Was also jeweils im Unterricht geschieht, hängt<br />
nicht allein von den individuellen Lernvoraussetzungen des Kindes ab, auf deren Feststellung<br />
in neuerer Zeit auch in der FLEX durch den Einsatz von Beobachtungsverfahren besonderer<br />
Wert gelegt wird (FLEX-Handbuch 6b: Förderdiagnostische Lernbeobachtung).<br />
Vielmehr ist von wesentlicher Bedeutung, wie die Aufgaben gestellt wurden, wie die Schülerinnen<br />
und Schüler vororientiert wurden, wie Kinder das aufnehmen konnten, welche persönlichen<br />
Anknüpfungspunkte jedes Kindes bei der differenzierten Arbeit am gemeinsamen Gegenstand<br />
zur Sache bestehen, welche Freiheitsgrade die Aufgabe enthält und zugleich, ob<br />
ein geeignetes Gerüst zur Verfügung gestellt wird, das dem Kind Verstehen und Strukturieren<br />
ermöglicht.<br />
Auf der Seite der Lehrerinnen und Lehrer setzt das voraus, dass sie in der Lage sind, den<br />
Inhalt aus fachlicher und aus Sicht der verschiedenen Kinder zu durchdenken. Aus beidem<br />
zusammen erst ergibt sich eine didaktische Perspektive, mit der die Anforderungen der Aufgaben<br />
eines gemeinsamen Gegenstands auf dem Weg zur Fachlichkeit im Sinne eines Spiralcurriculums<br />
modelliert, Differenzierungen gedacht, Schülerleistungen reflektiert werden<br />
können und sowohl die sachliche Lernumgebung (die Werkzeuge der Kinder) eingerichtet als<br />
auch das Unterrichtsformat ausgewählt werden kann. Schließlich ist die individuelle Lernbegleitung,<br />
das gemeinsame Reflektieren mit den Kindern, gerade auch beim Üben zentral.<br />
Aus Sicht der Lehrkraft geht es darum zu verstehen, wie das Kind denkt und wie sie als<br />
Lehrperson mit dem Kind in eine echte inhaltliche Auseinandersetzung eintreten kann, die<br />
seine Denkweise als interessant und bedeutsam für den Lerngegenstand akzeptiert, ihr aber<br />
auch inhaltlich entgegnet und verdeutlich, dass eine gute Arbeitsplanung und eine Überprüfung<br />
des schon Gelernten erforderlich ist. Zwischen Lehrangebot und Lernergebnis muss<br />
174