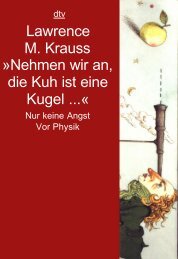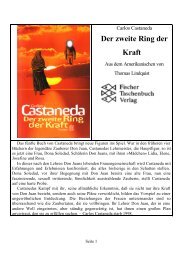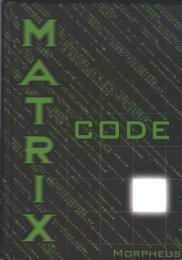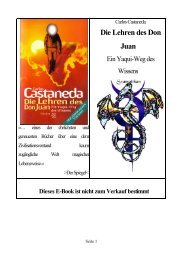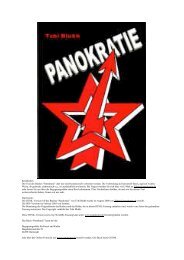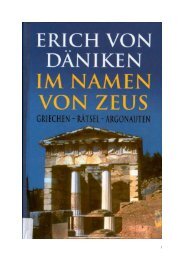Die Apokryphen - Verborgene Bücher der Bibel
Die Apokryphen - Verborgene Bücher der Bibel
Die Apokryphen - Verborgene Bücher der Bibel
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
183<br />
Um 1170 begleitet diese Szene in einer Salemer Handschrift den visionären Text aus einer Dichtung <strong>der</strong> Hildegard von Bingen. Auch das<br />
Kunstgewerbe übernahm dieses Motiv. Auf <strong>der</strong> Teppichfolge von Angers (1377-1381) ist es zu bewun<strong>der</strong>n. Vom 13. bis zum 15. Jh. gehörte<br />
es zum festen Bestandteil des Jüngsten-Gerichts-Zyklus.<br />
In den Armenbibeln (Biblia pauperum) des 14. und 15. Jhs. wird Henochs Aufnahme in den Himmel <strong>der</strong> Himmelfahrt Christi<br />
gegenübergestellt. <strong>Die</strong>selbe Thematik zeigen auch die Glasfenster <strong>der</strong> Franziskanerkirche in Esslingen vom Ende des 13. Jh.<br />
Vor etwas mehr als einem Jahrhun<strong>der</strong>t ehrte <strong>der</strong> englische Maler und Mystiker William Blake (1757-1827)<br />
seinen großen Geistesverwandten mit einer Lithographie, entstanden 1805-1807. Außerdem fertigte er eine<br />
Reihe von Zeichnungen zum Buch Henoch.<br />
Der Prophet Jesaja<br />
Zur Visionsliteratur des christlichen Altertums gehört noch eine an<strong>der</strong>e Apokryphe: <strong>Die</strong> Himmelfahrt und das Martyrium des Jesaja. <strong>Die</strong>ser<br />
Prophet ist auch im Alten Testament vertreten, als Kün<strong>der</strong> <strong>der</strong> Geburt des Messias. Dagegen erzählt die apokryphe Schrift von seinem<br />
gewaltsamen Tod unter König Manasse. <strong>Die</strong>ser ließ ihn, durch den Teufel aufgehetzt, zersägen.<br />
In <strong>der</strong> bildenden Kunst wird er deshalb meist im Moment des Zersägtwerdens dargestellt. So zeigen ihn die Heisterbacher Heilige Schrift,<br />
um 1240, und an<strong>der</strong>e <strong>Bibel</strong>n aus dem 13. Jh. Darüber hinaus ist er in <strong>der</strong> Deckenmalerei <strong>der</strong> Basilika von Brauweiler (bei Köln) zu sehen.<br />
<strong>Die</strong> Armenbibeln stellen sein Martyrium <strong>der</strong> Kreuzigung Christi gegenüber.<br />
<strong>Die</strong> zur Gattung <strong>der</strong> Visionsliteratur gehörenden Texte des Henoch und die Himmelfahrt des Jesaja haben bereits alle Formen ausgebildet,<br />
die später Dante Alighieri (1265-1321) in seiner Göttlichen Komödie (Divina comedia) so virtuos benutzt. <strong>Die</strong> Reise in Begleitung eines<br />
Engels durch die Unterwelt und die sechs Himmel zum siebenten, in dem <strong>der</strong> Unnennbare sitzt. Dantes Dichtung steht also in <strong>der</strong> Tradition<br />
<strong>der</strong> Visionsliteratur, zu <strong>der</strong> auch die beiden <strong>Apokryphen</strong> gehören. Sie ist Höhepunkt und Abschluß dieses Literaturtyps.<br />
<strong>Die</strong> Weissagungen <strong>der</strong> Sibyllen<br />
In einer noch älteren Tradition stehen die Sibyllinischen Orakel. Bereits die vorattische Zeit kannte ihre Weissagungen, und Rom besaß eine<br />
Sammlung sibyllinischer Sprüche, die, von einem eigenen Kollegium betreut, zu Rate gezogen wurden, wenn außerordentliche<br />
Begebenheiten den Senat beunruhigten.<br />
Sibyllinische Weissagungen waren in Mode, und so fabrizierte sich auch das alexandrinische Judentum zum Zweck <strong>der</strong> monotheistischen<br />
Propaganda Sibyllensprüche.<br />
Zu dieser Zeit war <strong>der</strong> ursprüngliche Eigenname längst in einen Gattungsnamen übergegangen. Der römische Schriftsteller Marcus Terentius<br />
Varro (116-27 v Chr. ) unterschied schon zehn Sibyllen, nach den Orten, an denen sie lebten. Der jüdischen Bearbeitung folgte die<br />
christliche, die diese Literaturgattung ebenfalls als nützlich für ihre Propagandazwecke ansah. <strong>Die</strong>ser jüdisch-christliche Text, entstanden<br />
zwischen dem 2. vor- und dem 4. nachchristlichen Jahrhun<strong>der</strong>t, wurde unter dem Titel Oracula Sibyllina in die <strong>Apokryphen</strong> eingereiht.<br />
<strong>Die</strong> Kirchenväter sahen in diesen Weissagungen, analog zu <strong>der</strong> Ankündigung des Messias durch die Propheten des Alten Testaments,<br />
Hinweise auf die Ankunft des Gottessohns.<br />
<strong>Die</strong> Sammlung hatte großen Einfluß auf die Kunst des Mittelalters und <strong>der</strong> Renaissance. Schon im 6. /7. Jh. sind Sibyllendarstellungen<br />
nachweisbar. Gruppendarstellungen von vier, zehn o<strong>der</strong> zwölf Sibyllen treten seit dem 11. Jh. auf. <strong>Die</strong> Hrabanus-Maurus-Handschrift, um<br />
1022-1023 auf dem Monte Cassino entstanden, zeigt zehn von ihnen zusammen mit zehn heidnischen Philosophen. Auf einem Fresko im<br />
Limburger Dom sind vier Sibyllen mit vier Propheten abgebildet und in einem Missale von 1481 sind zwölf Sibyllen bei <strong>der</strong> Verkündigung<br />
zugegen.<br />
Das wun<strong>der</strong>gläubige Mittelalter erweiterte die Kompetenz <strong>der</strong> Seherinnen noch und unterstellte ihnen auch die Passion, die Auferstehung<br />
und die Wie<strong>der</strong>kehr Christi beim Jüngsten Gericht vorausgesagt zu haben.<br />
In diesem Sinne sind zehn Sibyllen auf dem Chorgestühl, das Jörg Syrlin d. Ältere in den Jahren 1469-1474 geschaffen hat, dargestellt. Auch<br />
am Memminger Chorgestühl, einer großartigen Gemeinschaftsleistung mehrerer Memminger Meister, entstanden von 1501-1507, weisen<br />
zwölf Sibyllen mit zehn Propheten auf den Welterlöser hin. In Glas- und Buchmalerei sowie in Bockbuchausgaben wurden die Sibyllen mit<br />
ihren Weissagungen abgebildet. Sehr beliebt waren Sibyllendarstellungen in <strong>der</strong> Kunst <strong>der</strong> italienischen Renaissance. <strong>Die</strong> Sibyllen des<br />
Michelangelo (1475-1564) in <strong>der</strong> Deckenmalerei <strong>der</strong> Sixtinischen Kapelle (1508-1512) beeindrucken auch heute noch den Betrachter.<br />
Auch in <strong>der</strong> Kunst des Barocks hatten sie noch ihren Platz und waren sogar in <strong>der</strong> Profankunst, zum Beispiel auf Ofenplatten, verbreitet.<br />
<strong>Die</strong> Lücken im Neuen Testament<br />
Was die Sibyllen > erschauten ... über das, was sich unter uns zugetragen hat, einen Bericht<br />
abzufassen<<br />
(Lukas 1,1). Es kursierten also viele Texte in den frühchristlichen Gemeinden. Mit <strong>der</strong> Herausbildung <strong>der</strong> Kirche als Organisation, wozu<br />
auch die Einheit in Lehre und Kult gehörte, begann die neutestamentliche Kanonbildung. Ein Teil <strong>der</strong> Schriften wurde von den<br />
Kirchenlehrern zu einem Kanon zusammengestellt, alles übrige für falsch, häretisch und verwerflich erklärt.<br />
Über das Zustandekommen des Kanons berichtet eine Legende: Alle <strong>Bücher</strong> wurden vor einem Altar aufgestapelt. Da sprangen die<br />
kanonischen auf den Altar, die apokryphen dagegen blieben machtlos liegen.<br />
Der Prozeß <strong>der</strong> Kanonbildung zog sich in Wirklichkeit über Jahrhun<strong>der</strong>te hin und wurde erst auf dem Konzil von Trient, (1546) endgültig<br />
abgeschlossen.<br />
Ebensowenig schnell ließen sich die verworfenen, jetzt mit dem Neuen Testament konkurrierenden <strong>Bücher</strong> verdrängen. Indes wurde mit<br />
zunehmen<strong>der</strong> Festigung des Kanons auch die rigide Haltung den abgelehnten <strong>Bücher</strong>n gegenüber lockerer, hatten doch die Kirchenväter sie<br />
geschätzt und daraus zitiert. Und gegen ihren Gebrauch als fromme Erbauungsliteratur war nichts einzuwenden, solange <strong>der</strong> Kanon <strong>der</strong> <strong>Bibel</strong><br />
als einzige richtungweisende Grundlage des Glaubens akzeptiert wurde. Beinhalten die <strong>Apokryphen</strong>, nach Meinung ihrer damaligen<br />
Befürworter, ja nichts gegen den Glauben Gerichtetes. Im Gegenteil! Sie unterstützen die kanonischen Schriften durch interessante<br />
Mitteilungen, ergänzen die an manchen Stellen kärglichen Evangelien. So berichten sie ausführlich über das Leben Mariens, die Kindheit<br />
Jesu, sein Leiden und Sterben, über seine Höllenfahrt und Auferstehung sowie über die Taten <strong>der</strong> Apostel. Sie ordnen die Geschehnisse in<br />
einen zeitlichen Rahmen ein und beseitigen dadurch manche Unklarheit. Theologische Tendenzen, aufrichtige Frömmigkeit und tiefe Glaubenserlebnisse<br />
sind auch in diesen Texten enthalten.<br />
In diesem Sinne konnte beides, <strong>Bibel</strong> und apokryphe Schriften, als Quelle für die Literatur und als Grundlage <strong>der</strong> bildenden Kunst<br />
herangezogen werden. Am nachhaltigsten hat das Jakobusevangelium, seit dem 16. Jh. auch Protevangelium des Jakobus genannt, auf