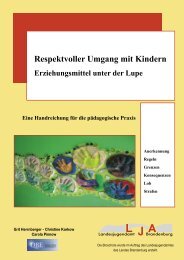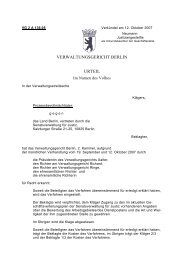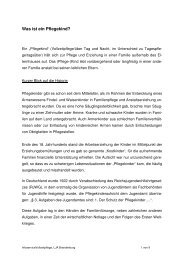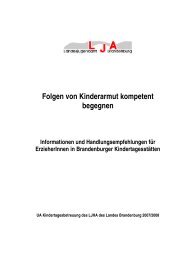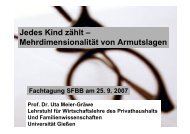Arbeiten mit alkoholbelasteten Familien im Handlungsfeld der ...
Arbeiten mit alkoholbelasteten Familien im Handlungsfeld der ...
Arbeiten mit alkoholbelasteten Familien im Handlungsfeld der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
son<strong>der</strong>n eher einen Ausdruck von Hilflosigkeit. Gerade das lange „Zusehen“, ohne<br />
den Betreffenden auf sein Trinken anzusprechen, führt dazu, dass er <strong>im</strong>mer weiter in<br />
die Abhängigkeit gerät. Dabei ist es ganz unterschiedlich, was Trinkende motivieren<br />
kann, aus dem bisherigen Trinkverhalten auszusteigen. Bei manchen ist es<br />
tatsächliche <strong>der</strong> totale Zusammenbruch ihrer sozialen Bezüge o<strong>der</strong> eine starke<br />
Schädigungen <strong>der</strong> Gesundheit. Bei an<strong>der</strong>en kann es <strong>der</strong> drohende Verlust des<br />
Arbeitsplatzes o<strong>der</strong> <strong>der</strong> wichtiger Bezugspersonen sein. Gerade die Liebe zu den<br />
eigenen Kin<strong>der</strong>n kann ein wesentlicher Beweggrund sein, <strong>mit</strong> dem Trinken (in <strong>der</strong><br />
bisherigen Weise) aufzuhören - ein Motiv, welches häufig nicht genügend genutzt<br />
wird, wenn es darum geht, <strong>mit</strong> den Eltern zu arbeiten. Für an<strong>der</strong>e wie<strong>der</strong>um reicht es<br />
zu wissen, dass ihr Trinkverhalten von Außenstehenden kritisch wahrgenommen<br />
wird, um ein Umdenken in Gang zu bringen. Deshalb ist es so wichtig, <strong>mit</strong> den<br />
Betroffenen offen über ihr Trinken und dessen möglichen Folgen zu reden.<br />
1.3.1. Vermeidung von Co-Verhalten in professionellen Zusammenhängen<br />
Ebenso wie die <strong>Familien</strong><strong>mit</strong>glie<strong>der</strong> und Personen des sozialen Umfeldes laufen auch<br />
professionelle Helfer Gefahr, dem natürlichen Impuls nachzugeben und Muster von<br />
Co-Verhalten zu zeigen - die sich letztlich ebenso problemstabilisierend auswirken<br />
wie die duldenden, deckenden o<strong>der</strong> unterstützenden Handlungen Nahestehen<strong>der</strong>.<br />
Beispiele hierfür sind z.B. die Sozialarbeiterin, die eine trinkende Mutter bittet <strong>mit</strong><br />
dem Trinken aufzuhören, bzw. darauf drängt, eine Alkoholtherapie zu machen, o<strong>der</strong><br />
ihr droht, bald „an<strong>der</strong>e Seiten aufzuziehen“ (ohne es dann zu tun). O<strong>der</strong> die<br />
<strong>Familien</strong>helferin, die „die Ärmel hochkrempelt“, für Ordnung sorgt, den Klienten das<br />
Geld einteilt, und sich zur Entlastung um die Kin<strong>der</strong> kümmert. Aber auch subtilere<br />
Muster, wie ein Teilen des Tabus des <strong>Familien</strong>gehe<strong>im</strong>nisses, o<strong>der</strong> wenn man<br />
Gespräche <strong>mit</strong> Klienten unter Alkoholeinfluss führt, obwohl es eine an<strong>der</strong>e<br />
Vereinbarung gibt, fallen unter das, was hier <strong>mit</strong> „Co-Verhalten“ bezeichnet werden<br />
soll.<br />
So verständlich diese Verhaltensweisen in anbetracht <strong>der</strong> misslichen Lage sind, so<br />
folgenschwer sind sie in ihren Auswirkungen: Meist werden sie von den trinkenden<br />
Eltern als Botschaft verstanden, dass sie nichts an ihrem Trinkverhalten än<strong>der</strong>n<br />
müssten - da man sie ja von den Konsequenzen entlastet.<br />
Der Sog in die Co-Abhängigkeit stellt eine <strong>der</strong> größten Schwierigkeiten für<br />
Professionelle dar. Aus unserer Sicht gehört es zur typischen Dynamik bei<br />
Alkoholproblemen, dass das System <strong>im</strong>mer wie<strong>der</strong> versteckte „Einladungen“ in das<br />
Co-Muster ausspricht. Alkoholsysteme verwenden viel Energie darauf, dass „nichts<br />
klar wird“ - eine Form von Wi<strong>der</strong>stand gegen Einmischung bzw. Schutz vor<br />
Verän<strong>der</strong>ungen, die als bedrohlich erlebten. Durch wechselnde Anliegen<br />
beispielsweise und <strong>im</strong>mer neue Katastrophen können Helfer leicht verwirrt werden<br />
o<strong>der</strong> das Gefühl bekommen, die Klienten nicht richtig „zu fassen zu kriegen“. Der<br />
Helfer hat dann das Gefühl, nicht richtig durchzublicken o<strong>der</strong> <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Familie<br />
verstrickt zu sein. In <strong>der</strong> Kooperation <strong>mit</strong> an<strong>der</strong>en Fachkräften entstehen oft<br />
Unst<strong>im</strong>migkeiten und Verschiebungen von Verantwortung. Teilweise scheinen die<br />
Klienten Intrigen zu initiieren, die die Fachkräfte in ihrer Wirksamkeit lähmen (zur<br />
Abst<strong>im</strong>mung auf Helferebene: s. Teil 2, Kap. 6: Kooperation). Dies halten wir für eine<br />
13