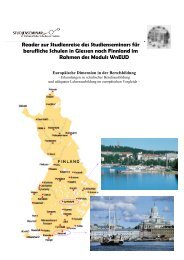Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- die Mikrozensusauswertungen (im Folgenden werden die der Jahre 1987, 1989 und 1998<br />
herangezogen),<br />
- das sozioökonomische Panel,<br />
- die Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerkes,<br />
- das von ‚Infratest Burke Sozialforschung‘ erstellte Berichtssystem Weiterbildung und<br />
- neuerdings die PISA-Studie.<br />
Dazu kommen – in größerer Fülle – regionale Erhebungen, die aber keine Repräsentativität beanspruchen<br />
können. Die folgende kommentierte Zusammenstellung stützt sich auf diese Quellen,<br />
bezieht sich dabei überwiegend auf das Gebiet der früheren Bundesrepublik (da die Ausdifferenzierung<br />
der sozialen Herkunft im Gebiet der früheren DDR mit den herangezogenen Kategorien der<br />
Sozialversicherung nicht zu vergleichbaren Ergebnissen führen kann) und verfährt dabei so, dass –<br />
dem Stufenaufbau des Bildungssystems folgend – Daten zur sozialen Chancenverteilung im Bildungssystem<br />
präsentiert werden. Dabei wird die soziale Herkunft weniger aus systematischen Erwägungen<br />
als wegen der Verfügbarkeit entsprechender Daten zumeist durch die Kategorien des<br />
Sozialversicherungssystems beschrieben – mit all den Problemen, die damit verbunden sind.<br />
Zum Elementarbereich:<br />
Die Auswertung des Mikrozensus’ 2000 zeigt (vgl. BMBF 2002, S. 45) für Deutschland, dass es bei<br />
der Beteiligung am Kindergarten und am Hort keine starken schichtspezifischen Ausdifferenzierungen<br />
gibt: Von den 3- bis unter 8jährigen Kindern besuchen aus Arbeiterfamilien 77% und aus Angestellten-<br />
ebenso wie aus Beamtenfamilien 82% einen Kindergarten oder einen Hort.<br />
Zum Sekundarbereich I:<br />
1989 wurde im Rahmen der Mikrozensus-Befragung zum letzten Mal erfragt, welche Bildungswege<br />
der Sekundarstufe I Jugendliche im entsprechenden Alter besuchen. Seither fehlen dazu repräsentative<br />
Daten des Mikrozensus. Die Befunde des Jahres 1989 (vgl. Böttcher 1991) weisen allerdings<br />
auf eine damals noch sehr ausgeprägte schichtspezifische Verteilung der Bildungschancen hin:<br />
- So besuchten 1989 nur 11% der Kinder aus Familien, deren Haushaltsvorstand Arbeiter bzw.<br />
Arbeiterin war, ein Gymnasium – bei einer Beteiligungsquote der gesamten Bevölkerung in<br />
Höhe von 29% und gegenüber 58% der Kinder aus Beamtenfamilien.<br />
- Bei der Realschule dagegen entspricht die Beteiligungsquote der Arbeiterkinder mit 26% in<br />
etwa der der Gesamtpopulation (26%). Zur Realschule lässt sich feststellen, dass die Beteiligung<br />
an diesem Bildungsgang mit Werten zwischen 25% und 30% bei allen betrachteten Sozialgruppendicht<br />
beieinander liegt.<br />
- Ein der gymnasialen Bildungsbeteiligung entgegenstehendes Bild ergibt sich für die Hauptschule:<br />
Dorthin wechseln nur 13% der Beamten-, aber 58% aller Arbeiterkinder.<br />
<strong>Das</strong>s die Gruppe der Arbeiterkinder mit ihrer so offenkundigen Bildungsbenachteiligung keine<br />
Randgruppe der Gesellschaft darstellt, zeigt ein Blick auf die schichtspezifische Zusammensetzung<br />
eines Altersjahrgangs (vgl. Böttcher 1991, S. 153): 1989 stammten 38% aller Dreizehn- und Vierzehnjährigen<br />
aus Arbeiter-, 28% aus Angestellten- und 10% aus Beamtenfamilien. Die übrigen<br />
Jugendlichen kamen aus Familien, in denen der Familienvorstand selbständig oder nicht erwerbstätig<br />
war. <strong>Das</strong> Muster der schichtspezifischen Bildungsbeteiligung, das in diesen Daten zum Ausdruck<br />
kommt, wiederholt sich bei einer geschlechtsspezifischen Betrachtung der Bildungsbeteiligung<br />
in der Sekundarstufe I: In der Gruppe der Jungen liegen ebenso wie in der der Mädchen die<br />
Kinder aus Beamtenfamilien vor denen aus Angestelltenfamilien, die wiederum die Kinder aus Arbeiterfamilien<br />
übertreffen.<br />
Es wäre mehr als voreilig, die gemessenen schichtspezifischen Ausprägungen bei der Bildungsbeteiligung<br />
aus der ökonomischen Lage der jeweiligen Familien zu erklären. Eine ältere Auswertung<br />
des Mikrozensus’ 1987, die in ihren zentralen Ergebnissen auch derzeit noch Gültigkeit haben dürfte,<br />
hat gezeigt, dass innerhalb vergleichbarer Einkommensgruppen die Bildungsbeteiligung mit der<br />
Stellung des Berufs des Familienvorstandes variiert (vgl. Klemm u.a. 1990, S. 91 f. sowie zur sozialisationstheoretischen<br />
Erklärung Rolff 1997): In jeder der drei bei der Untersuchung ausgewählten<br />
Einkommensgruppen ist die Bildungsbeteiligung der Arbeiterkinder deutlich geringer als die der<br />
Kinder aus Angestellten- und Beamtenfamilien. Darüber hinaus gilt, dass ihr Anstieg bei den Kindern<br />
aus Arbeiterfamilien von der unteren zur mittleren Einkommensgruppe nur sehr schwach ausfällt<br />
(bei der gymnasialen Beteiligungsquote von 11% auf 13%), während die Bildungsbeteiligungs-<br />
39