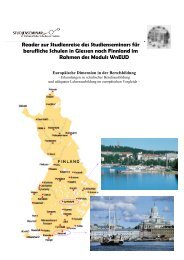Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. Die historische Perspektive: Zur <strong>Entstehung</strong> des <strong>deutsche</strong>n<br />
<strong>Schulsystem</strong>s<br />
Im Folgenden soll in groben Zügen die <strong>deutsche</strong> Schulgeschichte skizziert werden. Dabei bezieht<br />
sich die Darstellung (vgl. Herrlitz u.a. 1993) exemplarisch, soweit es die Zeit bis 1918 angeht (vgl.<br />
für eine Übersicht Abb. 1.1, S. 6) , auf die Entwicklung in Preußen; für die Zeit danach (vgl. für eine<br />
Übersicht Abb. 1.2, S. 21) bezieht sich der Text auf Deutschland insgesamt bzw. – für die Jahre zwischen<br />
1945 und 1989 – auf die beiden <strong>deutsche</strong>n Staaten.<br />
2.1 Triebkräfte für den Ausbau des öffentlichen Schulwesens in Preußen<br />
Die Durchsetzung der Schulpflicht und die Etablierung eines staatlich organisierten, finanzierten<br />
und kontrollierten <strong>Schulsystem</strong>s im Verlauf des 19. Jahrhunderts verdankt sich in Preußen (und in<br />
ähnlicher Weise im gesamten deutschsprachigen Raum) drei Faktoren:<br />
- dem etatistischen Interesse, Schulen als Mittel zur Herausbildung eines Staats- und Nationalbewusstseins<br />
zu nutzen (Legitimationsfunktion der Schule),<br />
- dem ökonomischen Interesse, die Entwicklung von Wirtschaft und vor allem staatlicher Verwaltung<br />
durch qualifiziertes Personal (Qualifikationsfunktion und Selektionsfunktion der<br />
Schule) zu fördern sowie<br />
- dem emanzipatorischen Interesse der Einzelnen, durch Bildung die eigenen Lebensmöglichkeiten<br />
zu erweitern (Qualifikationsfunktion der Schule).<br />
Herrlitz, H.-G./Hopf, W./Titze, H. fassen diesen Tatbestand wie folgt zusammen (in: Institutionalisierung<br />
des öffentlichen <strong>Schulsystem</strong>s. In: Lenzen, D.: (Hrsg.): Enzyklopädie Erziehungswissenschaft<br />
Band V, S. 55-71. Stuttgart 1984):<br />
„In der historischen Entwicklung der letzten 200 Jahre hat sich die Schule als öffentliche Einrichtung für<br />
Massenlernprozesse weltweit durchgesetzt. Diese Entwicklung legt den Schluss nahe, dass sie eine erfolgreiche<br />
gesellschaftliche Problemlösung für fundamentale Funktionsbedürfnisse moderner Gesellschaften<br />
darstellt. Die Entwicklung scheint unumkehrbar, da komplexe Gesellschaften die Lernprozesse der heranwachsenden<br />
Generation funktional verselbständigt und durch die Ausdifferenzierung eines in seinen<br />
Grenzen und Funktionen identifizierbaren Bildungssystems auf Dauer gestellt haben“ (S. 56).<br />
Am Beginn der von Herrlitz u.a. angesprochenen Entwicklungsphase formuliert K. A. v. Zedlitz,<br />
preußischer Justizminister unter Friedrich dem Großen, in seiner Schrift „Vorschläge zur Verbesserung<br />
des Schulwesens in den Königlichen Landen“ (1787) die Unzufriedenheit mit den schulischen<br />
Verhältnissen Preußens gegen Ende des 18. Jahrhunderts:<br />
„Wenn der Schulunterricht den Endzweck haben soll, die Menschen besser und für ihr bürgerliches Leben<br />
brauchbar zu machen, so ist es ungerecht, den Bauer wie ein Tier aufwachsen, ihn einige Redensarten,<br />
die ihm nie erklärt werden, auswendig lernen zu lassen; und es ist eine Torheit, den künftigen Schneider,<br />
Tischler, Krämer wie einen künftigen Konsistorialrat oder Schulrektor zu erziehen, sie alle Lateinisch, Griechisch,<br />
Hebräisch zu lehren und den Unterricht in Kenntnissen, die jene nötig haben, ganz zu übergehen<br />
oder diese Kenntnisse für sie unverständlich und unanwendbar vorzutragen. Darauf folgt also, dass der<br />
Bauer anders als der künftige Gewerbe oder mechanische Handwerke treibende Bürger und dieser wiederum<br />
anders als der künftige Gelehrte oder zu höheren Ämtern des Staates bestimmte Jüngling unterrichtet<br />
werden muss. Folglich ergeben sich drei Abteilungen aller Schulen des Staates, nämlich: 1) Bauern-,<br />
2) Bürger- und 3) Gelehrte Schulen“ (S. 74, in: Michael, B./Schepp, H.-H.: Die Schule in Staat und<br />
Gesellschaft. Dokumente zur <strong>deutsche</strong>n Schulgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen 1993, S.<br />
73-77).<br />
2.2 Die Herausbildung des <strong>Schulsystem</strong>s in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
In Preußen wurde, ähnlich wie in den anderen <strong>deutsche</strong>n Staaten, die allgemeine Schulpflicht im<br />
Verlauf des 18. Jahrhunderts wiederholt proklamiert (1717 „General Edict“, 1763 „Generalschulreglement“<br />
und 1794 „Allgemeines Landrecht“). Durchgesetzt werden konnte die Schulpflicht jedoch<br />
erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts: Während zu Beginn kaum mehr als die Hälfte der Jugendlichen<br />
eine Schule besuchten, taten dies gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahezu alle Jugendlichen.<br />
Innerhalb dieses Prozesses der Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht entwickelten sich<br />
– durchaus nach dem durch v. Zedlitz vorgegebenem Muster – das höhere, das mittlere und das<br />
niedere Schulwesen jedoch nach jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten.<br />
5