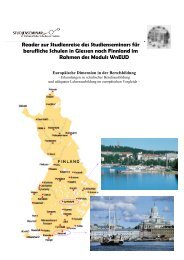Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
messen und daher der Einzelschule mit ihren individuellen Problemen bei der Weiterentwicklung<br />
nicht helfen zu können.<br />
■ Gründe für die aktuelle Schwerpunktlegung auf externe Evaluationsformen<br />
Obwohl es in der Fachdiskussion keinen Streit darüber gibt, dass eine allein auf Fremdevaluation<br />
setzende Steuerung der Schulen ihrer Weiterentwicklung wenig dienen wird, setzen die meisten<br />
Landesregierungen (Nordrhein-Westfalen noch am wenigsten) derzeit in erster Linie auf das Instrument<br />
der Fremdevaluation. Dies hat mehrere Gründe:<br />
- Autonomie und Sicherung der Vergleichbarkeit:<br />
Einen starken Auftrieb erhalten die Bemühungen um verstärkte externe Evaluation der Wirkungen<br />
der Schulen derzeit durch die Auseinanderentwicklung der <strong>Schulsystem</strong>e in Deutschland,<br />
die sich aus der traditionellen Autonomie der Länder (Kulturhoheit der Länder, vgl. Kapitel<br />
4.1) bei Fragen der Schulentwicklung ergibt.<br />
Insbesondere nach der Vereinigung der beiden <strong>deutsche</strong>n Staaten ist die Vielfalt im <strong>deutsche</strong>n<br />
Schulwesen stark angewachsen:<br />
□ Bundesweit schwankt die Schulpflichtzeit in allgemein bildenden Schulen zwischen<br />
neun und zehn Jahren,<br />
□ die Zeit, die bis zum Erreichen des Abiturs vergeht, reicht von 12 Jahren in einigen der<br />
neuen Bundesländer über zwölfeinhalb Jahre in Rheinland-Pfalz bis hin zu 13 Jahren in<br />
der Mehrheit der <strong>deutsche</strong>n Länder.<br />
□ Nicht weniger bedeutend sind die schulstrukturellen Unterschiede zwischen den Bundesländern.<br />
Im Bereich der Sekundarstufe I bestehen, wenn man die Sonderschulen<br />
nicht einbezieht, zweigliedrige Systeme in einigen der neuen Länder, z.B. in Sachsen,<br />
neben dreigliedrigen, z.B. in Bayern, und viergliedrigen, z.B. in Nordrhein-Westfalen<br />
(vgl. Kapitel 3.1)<br />
Diese Vielfältigkeit zeitlicher und struktureller Vorgaben wird sich infolge der politisch gewollten<br />
Verstärkung der Autonomie der Einzelinstitution auf die innere Schulentwicklung ausdehnen.<br />
Angesichts des schon erreichten und noch erwartbaren Ausmaßes der Ausdifferenzierung<br />
im <strong>Schulsystem</strong> wird das Bedürfnis nach Sicherung der Vergleichbarkeit insgesamt<br />
anwachsen. Die Verstärkung der externen Evaluation, bis hin zu der durch zentral gestellte<br />
und ausgewertete Tests im Verlauf der Schulkarrieren und durch ‚Zentralprüfungen’ an deren<br />
Abschluss, kann durchaus als das funktionale Äquivalent des derzeit wachsenden Föderalismus’<br />
und der zugleich politisch gewollten Autonomisierung der einzelnen Schulen begriffen<br />
werden.<br />
- Überfüllung, Selektion und Allokation:<br />
Weiteren Auftrieb erhalten Tendenzen, den ‚Output’ schulischer Arbeit stärker zu kontrollieren,<br />
durch das Anwachsen der Bildungsbeteiligung. Der Prozess der Bildungsexpansion hat<br />
in Deutschland dazu geführt, dass – gemessen an der Aufnahmekapazität der abnehmenden<br />
Systeme (z.B. des Dualen Systems, der Hochschulen, aber auch des Beschäftigungssystems)<br />
– ein Überangebot derer besteht, die aufgrund ihrer schulisch erworbenen und auch<br />
zertifizierten Berechtigungen Zugang zu diesen Systemen suchen. In dieser Konstellation eines<br />
Ungleichgewichts gewinnt die These, der zufolge die Überfüllung der nachfolgenden Systeme<br />
Folge einer Preisgabe von Standards bei der Vergabe der Zertifikate in den Zuliefersystemen<br />
sei, zusehends Prominenz. Wenn – so wird vorgebracht – die Selbststeuerung des<br />
Gesamtsystems bei der Qualitätssicherung versage, müssten die Steuerungssysteme geändert<br />
werden: Zentrale Prüfungen als besonders wirksame Instrumente externer Evaluation, so<br />
die These, seien geeignet, verloren gegangene Qualität und Vergleichbarkeit der erbrachten<br />
Leistungen wieder herzustellen.<br />
- Qualitätssicherung und Berechtigungswesen:<br />
Eng verknüpft mit der Überfüllungsdiskussion, mit den Auswirkungen des Kulturföderalismus’<br />
in Deutschland und mit der Entwicklung zu mehr Autonomie der Einzelschule erschüttert das<br />
durch die bereits erwähnten Vergleichsstudien festgestellte niedrige Leistungsniveau der<br />
<strong>deutsche</strong>n Schülerinnen und Schüler das System dezentraler Leistungskontrollen und Abschlussprüfungen.<br />
Insbesondere die im Rahmen dieser Studien aufgezeigten Leistungsunterschiede<br />
zwischen den Schülern und Schülerinnen der einzelnen Bundesländer stärkt den Ruf<br />
nach der Sicherung vergleichbarer Leistungen in den Schulen Deutschlands – und zwar<br />
60