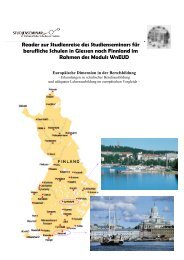Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
der Ausweitung schulisch vermittelter Qualifikationen wird abgelöst durch das der Qualitätssicherung.<br />
Unabhängig von all den Wechselfällen der neueren <strong>deutsche</strong>n Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts<br />
behauptet die Funktion der Schule, Qualifikationen zu vermitteln, ihre Stellung als einer<br />
der Dreh- und Angelpunkte der Schulentwicklung – wenn auch mit unterschiedlichen, gelegentlich<br />
sogar konträren Folgen für die jeweilige Schulpolitik.<br />
5.2 Selektion und Allokation<br />
Eine vergleichbare Konstanz kommt der schulischen Selektions- und der mit ihr verbundenen Allokationsfunktion<br />
zu. Mit dem Ende der Ständegesellschaft, das sich in Deutschland anders als in<br />
Frankreich mit seiner großen Revolution von 1789 weniger abrupt, sondern eher allmählich vollzog,<br />
übernahm die Schule auch in Deutschland eine in ihrer Bedeutung anwachsende Rolle bei<br />
der auf schulisch erbrachte Leistungen gestützten Auswahl junger Menschen (Selektion) und bei<br />
ihrer Zuweisung zu den hierarchisch gegliederten Positionen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft<br />
(Allokation). Neben dem Qualifikationsbedarf der Gesellschaft war es der Wechsel von der Standes-<br />
zur Leistungsgesellschaft, der der Schule im Verlauf des 19. Und 20. Jahrhunderts ihre überragende<br />
Stellung eröffnete.<br />
Dieser Systemwechsel, der sich überall im Prozess der gesellschaftlichen Modernisierung vollzog,<br />
wurde zwar bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert eingeleitet, fand aber erst mit dem Ende des<br />
Kaiserreiches einen vorläufigen Abschluss. Erst mit der Einführung einer gemeinsamen Grundschule<br />
durch den Weimarer Schulkompromiss (1919) konnte sich die Weichenstellung für unterschiedliche<br />
Schulkarrieren auf der Grundlage von in der (Grund-)Schule erbrachten schulischen<br />
Leistungen vollziehen. Die damit gegeben Öffnung schulischer Karrieren für Jungen und Mädchen<br />
aller sozialen Schichten machte erstmals in der <strong>deutsche</strong>n Schulgeschichte ernst mit dem Anspruch,<br />
das Erreichen gesellschaftlicher Positionen vom Erbringen schulischer Leistungen abhängig<br />
zu machen.<br />
Es war dann die relative Erfolglosigkeit dieses Versuchs, soziale Herkunft und schulischen Erfolg<br />
und damit gesellschaftliche sowie berufliche Karrieren zu entkoppeln, die in den sechziger Jahren<br />
dieses Jahrhunderts – gemeinsam mit der Sorge, nicht genügend Qualifikationen zu vermitteln –<br />
der <strong>Struktur</strong>reform des west<strong>deutsche</strong>n Bildungssystems seinen Antrieb verlieh. Angesichts der<br />
Einsicht in die „Illusion der Chancengleichheit“ (so titelte der französische Soziologe Bourdieu)<br />
wurde ein radikaler Umbau des Bildungssystems gefordert: Die gruppenspezifische Selektion im<br />
gegliederten <strong>Schulsystem</strong> und die damit verbundene „Vererbung“ sozialer Chancen von Generation<br />
zu Generation sollte in einem ungegliederten <strong>Schulsystem</strong>, in Gesamtschulen, aufgehoben,<br />
zumindest jedoch abgeschwächt werden.<br />
Der heftige Widerstand gegen diesen strukturellen Umbau erklärt sich nicht zuletzt daraus, dass<br />
die damit verbundenen Veränderungen schulischer Auslese die Verteilung gesellschaftlicher<br />
Chancen von Generation zu Generation in Frage gestellt hätte – zu Lasten der Mittel- und Oberschichten.<br />
Der Erfolg, den die Gegner einer Umstrukturierung des <strong>deutsche</strong>n <strong>Schulsystem</strong>s in<br />
Westdeutschland und nach 1989 mit der Auflösung der polytechnischen Oberschulen der DDR<br />
auch in Ostdeutschland verzeichnen konnten, wurde dadurch erleichtert und abgestützt, dass Länder<br />
mit gesamtschulähnlichen <strong>Schulsystem</strong>en bei ihren Bemühungen, zwischen den sozialen<br />
Schichten bestehende Chancenungleichheiten abzubauen, auch nur geringe Erfolge vorweisen<br />
konnten und können.<br />
Selektion und Allokation, so zeigt dieser knappe Überblick noch einmal, sind mit jeweils wechselndem<br />
Gewicht neben der Qualifikation ein weiteres konstantes Element der Schulentwicklung.<br />
5.3 Legitimation<br />
Ebenso wie auf die Qualifikations- und Selektionsfunktion führt eine Betrachtung der Schulentwicklung<br />
immer wieder zur Legitimationsfunktion der Schule. So wie die preußischen Herrscher im 19.<br />
Jahrhundert ihre Schulen immer wieder in den Dienst von ‚Krone und Altar’ gestellt haben (etwa<br />
bei der Bildungsbegrenzungspolitik der Stiehl’schen Regulative), so hat auch der nationalsozialistische<br />
Staat die Schulen zur Legimitation der nationalsozialistischen Diktatur und zur nationalsozialistischen<br />
Indoktrination genutzt. Auch er tat dies zu Lasten der Qualifikation der Schülerinnen und<br />
Schüler.<br />
66