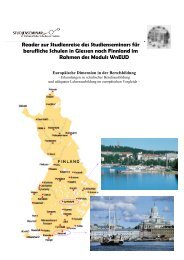Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Das deutsche Schulsystem. Entstehung, Struktur ... - Bildungswissen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5. Qualifikation, Selektion und Legitimation als konstante Elemente der<br />
Schulentwicklung<br />
Im Verlauf der bisherigen Darstellung wurden drei unterschiedliche Perspektiven eingenommen:<br />
<strong>Das</strong> <strong>deutsche</strong> <strong>Schulsystem</strong> wurde aus der Perspektive seiner Geschichte, aus der seiner gegenwärtigen<br />
<strong>Struktur</strong> und schließlich aus der seiner Steuerung untersucht. Diesem dreifachen Zugang<br />
wurde eine funktionalistische Betrachtung vorangestellt: Aus schultheoretischer Sicht wurden die<br />
Funktionen der Qualifikation, der Selektion (und damit verbunden der Allokation) und schließlich<br />
die der Legitimation dargestellt. Auf diese Funktionsbeschreibung soll nun abschließend – und das<br />
bisher Dargestellte zusammenfassend – zurückgegriffen werden.<br />
5.1 Qualifikation<br />
Am Beispiel Preußens wurde gezeigt, dass am Beginn der Etablierung eines modernen <strong>Schulsystem</strong>s<br />
das Interesse des Staates stand, den wachsenden Bedarf qualifizierter Beamter in darauf<br />
ausgerichteten Schulen heranzubilden. Die Verankerung des Abiturs als Abschlussprüfung der<br />
Gymnasien in den Jahren zwischen 1788 und 1834 war maßgeblich von dem Interesse geprägt, in<br />
den höheren Schulen eine gebildete Schicht für Führungsaufgaben im Staat und – später dann –<br />
in der Wirtschaft heranzuziehen. In der Frühphase der Industrialisierung Preußens, in der ersten<br />
Hälfte des 19. Jahrhunderts, konnte es der preußische Staat zulassen, dass sich schulische Qualifikationsanstrengungen<br />
überwiegend auf das höhere Schulwesen konzentrierten und dass sie sich<br />
am neuhumanistischen Bildungsverständnis eines Wilhelm von Humboldt orientierten.<br />
Im Verlauf des sich beschleunigenden Industrialisierungsprozesses verwandelten sich die inhaltlichen<br />
Anforderungen an die schulische Qualifikation; zudem weitete sich das Interesse an schulisch<br />
vermittelten Qualifikationen seitens des Staates, der im wachsenden Maße mit seiner Schulpolitik<br />
auf die Nachfrage aus dem nicht staatlichen Teil des Beschäftigungssystems reagieren<br />
musste, aus. Dieses gewachsene und ausgeweitete Qualifikationsinteresse führte im auslaufenden<br />
19. Jahrhundert zu Modernisierungsschüben:<br />
- <strong>Das</strong> höhere Schulwesen erhielt mit mathematisch-naturwissenschaftlichen und neusprachlichen<br />
Typen ein curricular modernisiertes Spektrum an Bildungsangeboten;<br />
- das niedere Schulwesen verlor allmählich seine Bestimmung als Institution zur Bildungsbegrenzung<br />
und wurde fachlich ausdifferenziert und materiell zugleich besser ausgestattet; parallel<br />
dazu wurde die Schulpflicht durchgesetzt.<br />
- Schließlich entwickelten sich in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die Grundzüge<br />
des Dualen Systems der Berufsbildung. Für all dies waren die Qualifikationsinteressen von<br />
Staat und Wirtschaft entscheidende Triebkräfte.<br />
Es war der gleiche Bedarf an schulisch vermittelter Qualifikation, der – nach der Phase der Bildungsbegrenzung<br />
im Dritten Reich – der Bildungsexpansion während der Reformjahre seit der<br />
Mitte der sechziger Jahre seine Dynamik gab: Allein das öffentliche Einklagen gleicher Bildungschancen<br />
– gestützt auf die Untersuchungen Dahrendorfs („Bildung ist Bürgerrecht“, 1965) – hätte<br />
in den sechziger Jahren und danach kaum ausgereicht, die Bildungsinstitutionen so weit, wie dies<br />
seither geschehen ist, zu öffnen und diesen Öffnungsprozess auch öffentlich zu finanzieren. Der<br />
Verweis auf die „<strong>deutsche</strong> Bildungskatastrophe“ durch Picht (1964) und auf die ökonomischen Folgen<br />
eines Mangels an ausreichend qualifizierten Beschäftigten hatte das Feld bereitet und vermochte<br />
– zusammen mit der bürgerrechtlichen Argumentation – die Kräfte zu mobilisieren, die die<br />
einsetzende Bildungsexpansion am Leben hielten.<br />
So wie der Qualifikationsbedarf, den Wirtschaft, Politik und auch Wissenschaft in den sechziger<br />
Jahren ausgemacht hatten, den expansiven Kurs des Bildungssystems erst ermöglichten, so ist es<br />
am Ende dieses Jahrhunderts die Sorge um den Standard der schulisch vermittelten Qualifikationen,<br />
die dazu beiträgt, dass der Expansionskurs der Reformjahre und auch der Jahre seither in<br />
Frage gestellt wird. Unter der Überschrift ‚Klasse statt Masse’ werden Empfehlungen formuliert und<br />
politische Maßnahmen eingeleitet, deren Ziel eine Umsteuerung ist: Die Erfolgsdaten der gestiegenen<br />
Bildungsbeteiligung verlieren an Bedeutung, werden zum Teil auch zu Vorboten eines großen<br />
bildungspolitischen Misserfolges umgedeutet; das öffentliche Interesse richtet sich auf Indikatoren,<br />
die etwas zur Qualität vermittelter Qualifikationen aussagen. <strong>Das</strong> gesellschaftliche Projekt<br />
65