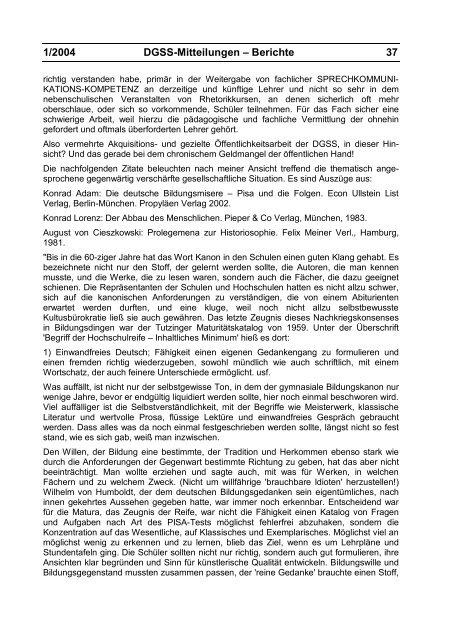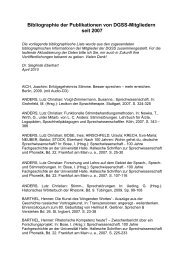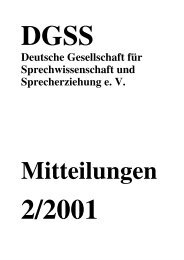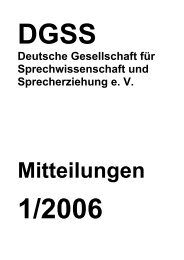Mitteilungen 1/2004 - Deutsche Gesellschaft für Sprechwissenschaft ...
Mitteilungen 1/2004 - Deutsche Gesellschaft für Sprechwissenschaft ...
Mitteilungen 1/2004 - Deutsche Gesellschaft für Sprechwissenschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1/<strong>2004</strong> DGSS-<strong>Mitteilungen</strong> � Berichte 37<br />
richtig verstanden habe, primär in der Weitergabe von fachlicher SPRECHKOMMUNI-<br />
KATIONS-KOMPETENZ an derzeitige und künftige Lehrer und nicht so sehr in dem<br />
nebenschulischen Veranstalten von Rhetorikkursen, an denen sicherlich oft mehr<br />
oberschlaue, oder sich so vorkommende, Schüler teilnehmen. Für das Fach sicher eine<br />
schwierige Arbeit, weil hierzu die pädagogische und fachliche Vermittlung der ohnehin<br />
gefordert und oftmals überforderten Lehrer gehört.<br />
Also vermehrte Akquisitions- und gezielte Öffentlichkeitsarbeit der DGSS, in dieser Hinsicht?<br />
Und das gerade bei dem chronischem Geldmangel der öffentlichen Hand!<br />
Die nachfolgenden Zitate beleuchten nach meiner Ansicht treffend die thematisch angesprochene<br />
gegenwärtig verschärfte gesellschaftliche Situation. Es sind Auszüge aus:<br />
Konrad Adam: Die deutsche Bildungsmisere � Pisa und die Folgen. Econ Ullstein List<br />
Verlag, Berlin-München. Propyläen Verlag 2002.<br />
Konrad Lorenz: Der Abbau des Menschlichen. Pieper & Co Verlag, München, 1983.<br />
August von Cieszkowski: Prolegemena zur Historiosophie. Felix Meiner Verl., Hamburg,<br />
1981.<br />
"Bis in die 60-ziger Jahre hat das Wort Kanon in den Schulen einen guten Klang gehabt. Es<br />
bezeichnete nicht nur den Stoff, der gelernt werden sollte, die Autoren, die man kennen<br />
musste, und die Werke, die zu lesen waren, sondern auch die Fächer, die dazu geeignet<br />
schienen. Die Repräsentanten der Schulen und Hochschulen hatten es nicht allzu schwer,<br />
sich auf die kanonischen Anforderungen zu verständigen, die von einem Abiturienten<br />
erwartet werden durften, und eine kluge, weil noch nicht allzu selbstbewusste<br />
Kultusbürokratie ließ sie auch gewähren. Das letzte Zeugnis dieses Nachkriegskonsenses<br />
in Bildungsdingen war der Tutzinger Maturitätskatalog von 1959. Unter der Überschrift<br />
'Begriff der Hochschulreife � Inhaltliches Minimum' hieß es dort:<br />
1) Einwandfreies Deutsch; Fähigkeit einen eigenen Gedankengang zu formulieren und<br />
einen fremden richtig wiederzugeben, sowohl mündlich wie auch schriftlich, mit einem<br />
Wortschatz, der auch feinere Unterschiede ermöglicht. usf.<br />
Was auffällt, ist nicht nur der selbstgewisse Ton, in dem der gymnasiale Bildungskanon nur<br />
wenige Jahre, bevor er endgültig liquidiert werden sollte, hier noch einmal beschworen wird.<br />
Viel auffälliger ist die Selbstverständlichkeit, mit der Begriffe wie Meisterwerk, klassische<br />
Literatur und wertvolle Prosa, flüssige Lektüre und einwandfreies Gespräch gebraucht<br />
werden. Dass alles was da noch einmal festgeschrieben werden sollte, längst nicht so fest<br />
stand, wie es sich gab, weiß man inzwischen.<br />
Den Willen, der Bildung eine bestimmte, der Tradition und Herkommen ebenso stark wie<br />
durch die Anforderungen der Gegenwart bestimmte Richtung zu geben, hat das aber nicht<br />
beeinträchtigt. Man wollte erziehen und sagte auch, mit was <strong>für</strong> Werken, in welchen<br />
Fächern und zu welchem Zweck. (Nicht um willfährige 'brauchbare Idioten' herzustellen!)<br />
Wilhelm von Humboldt, der dem deutschen Bildungsgedanken sein eigentümliches, nach<br />
innen gekehrtes Aussehen gegeben hatte, war immer noch erkennbar. Entscheidend war<br />
<strong>für</strong> die Matura, das Zeugnis der Reife, war nicht die Fähigkeit einen Katalog von Fragen<br />
und Aufgaben nach Art des PISA-Tests möglichst fehlerfrei abzuhaken, sondern die<br />
Konzentration auf das Wesentliche, auf Klassisches und Exemplarisches. Möglichst viel an<br />
möglichst wenig zu erkennen und zu lernen, blieb das Ziel, wenn es um Lehrpläne und<br />
Stundentafeln ging. Die Schüler sollten nicht nur richtig, sondern auch gut formulieren, ihre<br />
Ansichten klar begründen und Sinn <strong>für</strong> künstlerische Qualität entwickeln. Bildungswille und<br />
Bildungsgegenstand mussten zusammen passen, der 'reine Gedanke' brauchte einen Stoff,