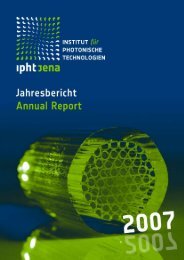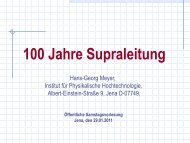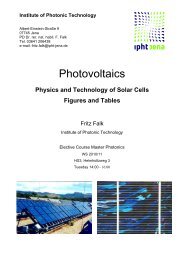Photovoltaik Physik und Technologie der Solarzellen - IPHT Jena
Photovoltaik Physik und Technologie der Solarzellen - IPHT Jena
Photovoltaik Physik und Technologie der Solarzellen - IPHT Jena
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 3 -<br />
Tab. 1.2: Wirtschaftlich nutzbare (Reserven) <strong>und</strong> zusätzliche, heute noch nicht wirtschaftlich<br />
nutzbare (Ressourcen) Vorräte an Energieträgern <strong>und</strong> Zeit, bis sie verbraucht sind (s. Text),<br />
Stand 2004 (Daten aus: J.P. Gerling, F.-W. Wellmer, Chemie in unserer Zeit 39 (2005), 236)<br />
Energieträger heutiger<br />
Anteil<br />
Reserven<br />
10 21 J<br />
Ressourcen<br />
10 21 J<br />
Reserven<br />
Jahre<br />
Kohle 0,232 20 117 65 125<br />
Öl 0,342 9 14 34 58<br />
Gas 0,196 6 7 38 57<br />
Gas <strong>und</strong><br />
Methanhydrat<br />
0,196 6 55 38 104<br />
Kernbrennstoff * 0,062 1 10 25 86<br />
Kernfusion 0<br />
* Ohne Brütertechnologie<br />
1.3 Das CO 2-Problem<br />
mit Ressourcen<br />
Jahre<br />
Gemäß Abb. 1.1 beruhen heute etwa 85% des Primärenergieeinsatzes auf <strong>der</strong> Verbrennung<br />
fossiler Rohstoffe, wodurch Kohlendioxid freigesetzt wird (weltweit 29@10 9 t im Jahr 2008, also<br />
4,3 t/Person). Vor dem Beginn <strong>der</strong> industriellen Revolution, als noch keine fossile Kohle<br />
verbrannt wurde, enthielt die Atmosphäre 280 ppm CO 2, heute enthält sie 390 ppm. Die<br />
zeitliche Entwicklung ist in Abb. 1.3 dargestellt. Der CO 2-Gehalt erhöht sich zur Zeit um 0,4%<br />
im Jahr. Bei dieser Steigerungsrate hat er sich in 100 Jahren auf das doppelte des vorindustriellen<br />
Wertes erhöht.<br />
CO 2 absorbiert Infrarotstrahlung im Wellenlängenbereich um 10 :m, wo das Maximum <strong>der</strong><br />
thermischen Ausstrahlung bei <strong>der</strong> Umgebungstemperatur liegt. Dadurch verringert sich die<br />
Abstrahlung <strong>der</strong> Erde <strong>und</strong> erhöht sich ihre mittlere Temperatur, wenn die sonstigen Bedingungen<br />
gleich bleiben: Treibhauseffekt. In Abb. 1.4 ist gezeigt, wie sich seit 1850 die mittlere<br />
Temperatur <strong>der</strong> Atmosphäre auf Bodenniveau verän<strong>der</strong>t hat. Dass die beobachtete Temperaturerhöhung<br />
tatsächlich die Folge des CO 2-Ausstoßes ist, wird kaum mehr bezweifelt (Abb. 1.5).<br />
Die Folgen des CO 2-Ausstoßes auf das Klima quantitativ vorherzusagen, ist schwierig: Zum<br />
einen können wir nicht genau vorhersagen, wie die Konzentration des CO 2 in <strong>der</strong> Atmosphäre<br />
vom Ausstoß abhängt. CO 2 wird von den Weltmeeren gelöst aufgenommen <strong>und</strong> eventuell sedimentiert,<br />
sowie in Pflanzen gespeichert. Die Effektivität dieser Senken hängt vom Klima ab.<br />
Selbst bei vorgegebenem CO 2-Gehalt <strong>der</strong> Atmosphäre ist es extrem schwierig, das Klima vorherzusagen,<br />
da viele an<strong>der</strong>e Faktoren nichtlinear eingehen. Ganz wesentlich ist wegen <strong>der</strong> Reflexion<br />
<strong>der</strong> Sonneneinstrahlung (Albedo) die Wolkenbedeckung, die stark von <strong>der</strong> Wassertemperatur<br />
<strong>der</strong> Ozeane abhängt. Daher muss ein Klimamodell auch die Ozeane mit ihren Strömungen<br />
umfassen.<br />
1 Die Energiewirtschaft <strong>und</strong> ihre Folgen F. Falk, <strong>Photovoltaik</strong> WS 2010/11