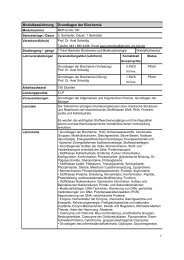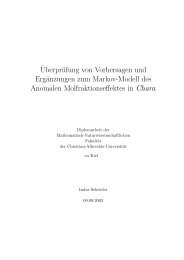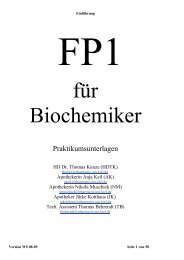Auflösung des schnellen Schaltens bei Patch-Clamp Untersuchungen
Auflösung des schnellen Schaltens bei Patch-Clamp Untersuchungen
Auflösung des schnellen Schaltens bei Patch-Clamp Untersuchungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 8: Fazit und Ausblick<br />
Die Frage ist, wie sicher obiges Ergebnis ist. Man könnte natürlich einwenden, es gäbe<br />
noch ein schnelles Schalten, das hier nicht entdeckt worden ist. Die Transferrate <strong>des</strong> Kanals<br />
<strong>bei</strong> 6 pA ist 10 8 Ionen/s. Die <strong>schnellen</strong> Ratenkonstanten liegen <strong>bei</strong> 15 000 Hz. In diesem<br />
Bereich mit einem Faktor 6000 kann sich noch einiges verbergen. Doch zur Zeit besteht keine<br />
Hoffnung, etwas zu finden. Die Amplitudenverteilung der gemessenen Daten (Fig. 7.3) läßt<br />
sich gut mit Gaußhügeln nähern. Prozesse mit Zeitkonstanten, die um den Faktor 10 höher<br />
liegen, würden bereits sehr deutliche Abweichungen erzeugen und zu Beta-Verteilungen<br />
führen. Also muß ein hypothetisches Schalten schnellere Zeitkonstanten als ca. 5 µs,<br />
wahrscheinlich sogar 1 µs besitzen.<br />
Dieser Bereich ist aber nur durch einen Technologiesprung zu erreichen, der sich im<br />
Moment nicht abzeichnet. Somit wird das Ergebnis dieser Ar<strong>bei</strong>t für die nächste Zeit die letzte<br />
Aussage zum <strong>schnellen</strong> Schalten <strong>bei</strong>m AMFE sein.<br />
In der Zukunft wird man sich also wieder stärker den Permeationsmodellen zuwenden.<br />
Hierfür ist wichtig, daß die symmetrischen Effekte auf die Strom-Spannungskurven, die von<br />
Draber et al. (1991) und Keunecke (1995) gemessen wurden, hier nicht auftraten. Die<br />
Symmetrie der Wirkung <strong>des</strong> AMFEs auf die Strom-Spannungskurven im positiven und<br />
negativen Spannungsbereich war das Hauptargument, das Permeationsmodell von Hille-<br />
Schwarz (1978) und Wu (1991,1992) auszuschließen und nach Gating-Modellen zu suchen.<br />
Albertsen (1994) und diese Ar<strong>bei</strong>t fanden nur einen einseitigen Effekt.<br />
Es ist nicht einsichtig, warum es zu diesen unterschiedlichen Ergebnissen kam.<br />
Insbesondere die Messungen von Keunecke (1995) und die Messungen dieser Ar<strong>bei</strong>t fanden<br />
unter fast identischen Bedingungen statt. Die erkennbaren Unterschiede waren wie folgt:<br />
Höhere Osmolarität in den Messungen hier (250 mM KNO3) im Gegensatz zu 150 mM KNO3<br />
<strong>bei</strong> Keunecke (1995). Doch erste Messungen in dieser Ar<strong>bei</strong>t mit 150 mM zeigten auch<br />
keinen symmetrischen AMFE. Der einzige Unterschied ist, daß Keunecke einen<br />
Lösungsaustausch durchführte und in der Kammer die Lösung wechselte, während hier für<br />
je<strong>des</strong> Mischungsverhältnis ein neuer <strong>Patch</strong> genommen wurde. Doch wie das den Unterschied<br />
erklären sollte, ist unverständlich.<br />
Diese Symmetriefrage hat nicht nur Bedeutung für eine mögliche Erklärung mit den oben<br />
genannten Permeationsmodellen, sondern auch für die Art der Bindungsstelle. Die hier<br />
gefundene Erklärung, daß die symmetrische Wirkung nur auftritt, wenn die Lösungen<br />
symmetrisch sind, paßt gut zur Vorstellung, daß der Strom das Tl + -Ion in den Kanal zieht und<br />
dort die wirksame Bindungsstelle trifft. Außerdem hatte sich <strong>bei</strong> anderen Ionenblocks (Na +<br />
Blunck, 1996; Cs + , Draber, 1994) gezeigt, daß die Wirkung einseitig war.<br />
Für die symmetrischen Wirkungen nahmen Draber et al. (1991) an, daß die<br />
Bindungsstelle an der Außenmembran sitzt und das einmal gebundene Ion den Fluß in <strong>bei</strong>de<br />
Richtungen beeinflußt. Keunecke (1995) benutzte inside-out-patches und Tl + -Lösung. Dann<br />
hätte die Bindungsstelle auf der cytosolischen Außenseite <strong>des</strong> Kanals liegen müssen, um den<br />
symmetrischen Effekt zu erklären.<br />
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse fallen Argumente gegen das Modell von Wu<br />
(1991, 1992) und Hille-Schwarz (1978) fort. Die Modelle müßten überar<strong>bei</strong>tet werden, um<br />
einige kleinere Widersprüche aufzulösen. Ein neuer Ansatz ist das Modell von Möller (1998),<br />
der in seiner Diplomar<strong>bei</strong>t eine Kombination aus Hille-Schwarz und dem enzymkinetischem<br />
Modell (Hansen et al., 1981) vorgeschlagen hat. Es ist aber noch nicht auf den AMFE<br />
angewandt worden.<br />
Es zeichnet sich also ab, daß die Reihe von AMFE-Ar<strong>bei</strong>ten so bald nicht zu Ende ist.<br />
Hier<strong>bei</strong> ist auch zu klären, warum die Strom-Spannungskurven mit und ohne Tl + <strong>bei</strong> 7°C<br />
konvergieren. Dies könnte auch den entsprechenden Befund von Blunck (1996) <strong>bei</strong>m Na + -<br />
Block in anderem Licht erscheinen lassen.<br />
78