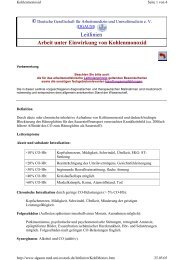Kinder besser schützen - Verband arbeits- und. berufsbedingt ...
Kinder besser schützen - Verband arbeits- und. berufsbedingt ...
Kinder besser schützen - Verband arbeits- und. berufsbedingt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
cher Chemikalien. Im Gegensatz zu Medikamenten, auf die in<br />
den meisten Fällen noch Einfluss durch bewussten Verzicht<br />
genommen werden kann, sind die Belastungen mit Schadstoffen<br />
das Ergebnis der lebenslangen Belastung der Mutter (World<br />
Health Organization et al., 2006).<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist die Belastung der Muttermilch mit Chemikalien<br />
besonders Besorgnis erregend. Dabei enthält Muttermilch<br />
nicht nur einen Anteil der Schadstoffe, die die Mutter<br />
selbst während der Schwangerschaft über die Nahrung aufnimmt.<br />
In ihr befinden sich darüber hinaus Giftstoffe, die sich<br />
über Jahre im Fettgewebe der Mutter angesammelt haben <strong>und</strong><br />
die nun mobilisiert werden (Gulson et al., 2003). Somit nimmt<br />
der gestillte Säugling über die Muttermilch beträchtliche Mengen<br />
an fettlöslichen Fremdstoffen wie PCB, Dioxine (Neubert,<br />
1994) oder auch Methylquecksilber (European Environment<br />
Agency & World Health Organization, 2002) auf. Die Aufnahme<br />
dieser Stoffe während des Stillens kann wesentlich höher<br />
sein als die bei Erwachsenen, dies gilt z.B. für Dioxine (B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Umwelt, Naturschutz <strong>und</strong> Reaktorsicherheit,<br />
2002). Dennoch kann das Stillen auch beim Entgiften<br />
einiger Schadstoffe eine positive Rolle spielen (World Health<br />
Organization et al., 2006), zudem ist der Chemikalienkontakt<br />
im Mutterleib entscheidender als der während des Stillens. Die<br />
Verwendung von industriellen Produkten auf Kuhmilchbasis als<br />
Muttermilchersatz kann die Chemikalieneinwirkung auf den<br />
Säugling nicht verhindern, wenngleich die Dioxinkonzentration<br />
in Kuhmilch wesentlich geringer ist als die in Muttermilch<br />
(Neubert, 1994).<br />
Im Alter von ab einem halben bis zwei Jahren wird die Muttermilch-<br />
<strong>und</strong>/oder Flaschenfütterung in der Regel beendet. Dennoch<br />
unterscheidet sich die Ernährung auch danach noch<br />
immer gr<strong>und</strong>legend von der der Erwachsenen. Gemessen an<br />
ihrem Körpergewicht ist der Konsum von Wasser beispielsweise<br />
siebenmal höher (Intergovernmental Forum on Chemical<br />
Safety, 2003). Zudem nehmen <strong>Kinder</strong> im Alter von ein bis fünf<br />
Jahren – bezogen auf das Körpergewicht – drei- bis viermal so<br />
viele Kalorien auf wie Erwachsene. Auch haben <strong>Kinder</strong> spezifische<br />
Nahrungsvorlieben. So trinkt ein durchschnittlicher Einjähriger<br />
wesentlich mehr Fruchtsaft <strong>und</strong> nimmt bestimmtes<br />
Obst wesentlich häufiger zu sich als der durchschnittliche<br />
Erwachsene. Folglich ist bei <strong>Kinder</strong>n in diesem Alter die Pesti-<br />
zid- oder Schwermetallaufnahme aus Getreide, Gemüse, Obst<br />
oder Säften besonders hoch. Die Hauptquelle der Chemikalienaufnahme<br />
stellt jedoch weiterhin die Kuhmilch dar, da auch sie<br />
von Kleinkindern mehr als von Erwachsenen konsumiert wird<br />
(European Environment Agency & World Health Organization,<br />
2002).<br />
Über die in Milchprodukten enthaltenen tierischen Fette sind<br />
Kleinkinder den fettlöslichen organischen Substanzen stärker<br />
ausgesetzt als Erwachsene. Zudem besteht bei industriell hergestellter<br />
Babynahrung gr<strong>und</strong>sätzlich auch die Gefahr einer<br />
Kontamination durch chemische Verunreinigungen. Auch das<br />
Trinkwasser kann unter anderem Substanzen wie Blei, Kupfer<br />
<strong>und</strong> Pestizide enthalten, die auch in Mengen unterhalb der<br />
zulässigen Grenzwerte für Kleinkinder gefährlich sein können.<br />
Doch die Chemikalienaufnahme über den M<strong>und</strong> ist - auch<br />
unabhängig von der Ernährung bei Kleinkindern - entschieden<br />
höher als bei Erwachsenen. Durch ihr Spielverhalten <strong>und</strong> ihre<br />
geringe Körpergröße halten sich <strong>Kinder</strong> häufig in Bodennähe<br />
auf. Da sich viele Giftstoffe in Bodennähe ablagern <strong>und</strong> sich im<br />
Hausstaub oder in der Erde ansammeln, führt dieses Verhalten<br />
zu besonders starkem Chemikalienkontakt (Intergovernmental<br />
Forum on Chemical Safety, 2003).<br />
Hinzu kommt, dass kleine <strong>Kinder</strong> viele Gegenstände sowie ihre<br />
Hände häufig in den M<strong>und</strong> nehmen. Dadurch nehmen sie deutlich<br />
mehr gefährliche Stoffe auf als dies durch bloßen Hautkontakt<br />
möglich wäre. Dieser M<strong>und</strong>kontakt ist besonders bei<br />
vielen Kunststoffen (z.B. Schnuller oder Spielzeug) gefährlich<br />
(Schneider et al., 2002). Häufig sind darin Weichmacher enthalten,<br />
die für eine Biegsamkeit des Materials sorgen, aber<br />
auch eine das Hormonsystem schädigende Wirkung haben.<br />
Andere Belastungen mit gefährlichen Chemikalien können z.B.<br />
durch den Gebrauch von lindanhaltigen Haarshampoos entstehen,<br />
die zur Behandlung von Kopfläusen <strong>und</strong> Krätze eingesetzt<br />
werden (Knust, 1998). Auch für <strong>Kinder</strong> ungeeignete Farbstifte<br />
können eine Gefahr darstellen, wenn sie beim Spielen in den<br />
M<strong>und</strong> genommen werden, wodurch die Farbstoffe direkt in den<br />
Körper gelangen.<br />
15