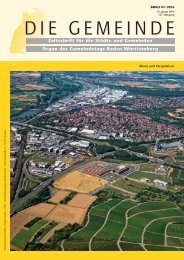BWGZ 1|2011 DIE GEMEINDE - Gemeindetag Baden-Württemberg
BWGZ 1|2011 DIE GEMEINDE - Gemeindetag Baden-Württemberg
BWGZ 1|2011 DIE GEMEINDE - Gemeindetag Baden-Württemberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>BWGZ</strong> 1 | 2011 Bilanz und Perspektiven<br />
Versteht man die Grundsteuer, wie im<br />
Eckpunktepapier von <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>,<br />
Bayern und Hessen dargestellt, als<br />
eine Art laufende Abgabe zur Finanzierung<br />
der kommunalen Infrastruktur, so<br />
ist der Gedanke einer verkehrswertunabhängigen<br />
einfach ermittelbaren Bemessungsgrundlage<br />
durchaus nachvollziehbar.<br />
Allerdings sind – wie dies auch in den<br />
Medien nach Veröffentlichung des Eckpunktepapiers<br />
seinen Niederschlag gefunden<br />
hat – die Auffassungen zum Verzicht<br />
auf jegliche Werthaltigkeit in der<br />
Bemessungsgrundlage geteilt, nicht nur<br />
mit Blick auf die Akzeptanz durch die<br />
verschiedenen Gruppen der Steuerpflichtigen,<br />
sondern auch mit dem Fokus auf<br />
die Hebesatzfestlegung in den Stadt- und<br />
Gemeinderäten. Die Ermittlung der<br />
Grundsteuer-Bemessungsgrundlagen<br />
nur mit drei Äquivalenzziffern anzugehen<br />
(2 Cent für die Grundstücksfläche<br />
[völlig losgelöst von den Bodenwertunterschieden<br />
innerhalb einer Gemeinde<br />
und zwischen den Gemeinden], 20 Cent<br />
für die nicht gewerblich genutzte Gebäude-Bruttogrundfläche<br />
und 40 Cent für<br />
die gewerblich genutzte Gebäude-Bruttogrundfläche)<br />
dürfte zum einen politisch<br />
nicht vermittelbar, zum anderen<br />
aber auch – weil zu stark pauschalierend<br />
– rechtlich angreifbar sein und sehr<br />
schnell wieder auf dem Prüfstand des<br />
Bundesverfassungsgerichts landen. Eine<br />
Verfeinerung mit Wertelementen innerhalb<br />
eines immer noch einfach zu haltenden<br />
Besteuerungsverfahrens hält<br />
auch die kommunale Praxis mehrheitlich<br />
für unumgänglich.<br />
Das Verkehrswertmodell<br />
Das Verkehrswertmodell basiert, wie erwähnt,<br />
auf einer Machbarkeitsstudie<br />
der Länder Berlin, Bremen, Niedersachsen,<br />
Sachsen und Schleswig-Holstein. In<br />
Anlehnung an die Rechtsprechung des<br />
Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer<br />
geht die Studie davon aus,<br />
dass sich die Bemessungsgrundlage für<br />
die Grundsteuer am Verkehrswert orientieren<br />
müsse. Über eine automationsgestützte<br />
Bewertung soll dementsprechend<br />
versucht werden, dem Verkehrswert<br />
möglichst nahe zu kommen, denn<br />
<strong>Gemeindetag</strong> <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong><br />
eine Bewertung aller zirka 35 Mio.<br />
Grundstücke in Deutschland aufgrund<br />
von Einzelgutachten ist ausgeschlossen!<br />
Deshalb wird in der Länderarbeitsgruppe<br />
der Finanzministerien auch die seit<br />
dem vergangenen Jahr neu geregelte Bewertung<br />
für Zwecke der Erbschaftsteuer<br />
als nicht auf die Grundsteuer übertragbar<br />
angesehen, weil es dabei jeweils um<br />
Steuerwerte im Einzelfall gehe. Für eine<br />
funktionsfähige verkehrswertorientierte<br />
Bewertung im Massenverfahren wird in<br />
der Länderarbeitsgruppe als Referenzbeispiel<br />
die in den Niederlanden seit<br />
1995 erfolgende Erhebung der Grundsteuer<br />
auf der Basis von Marktwerten<br />
angeführt (seit 2007 mit jährlichen Aktualisierungen<br />
durch die Kommunen,<br />
die allerdings freie Taxateure einsetzen).<br />
Ein weiteres Vorbild sieht die Länderarbeitsgruppe<br />
im Immobilien-Preis-Kalkulator<br />
(IPK) Niedersachsen.<br />
Das Verkehrswertmodell hält daran fest,<br />
land- und forstwirtschaftlich genutzte<br />
Grundstücke der Grundsteuer zu unterwerfen;<br />
diese Flächen sollen allerdings<br />
nicht mehr einer separaten Grundsteuer<br />
A unterliegen, sondern mit gewissen<br />
Modifikationen in die Grundsteuer B<br />
einbezogen werden.<br />
Zur Berechnung des Grundsteuerwertes<br />
nach dem Verkehrswertmodell werden<br />
folgende Daten benötigt:<br />
• Grundstücksdaten, d. h. die individuellen<br />
Daten des zu bewertenden<br />
Grundstücks (z.B. Lage, Grundstücksgröße,<br />
Wohn-/Nutzfläche, Gebäudeart,<br />
Baujahr). Weitere individuelle<br />
Merkmale, wie z.B. Ausstattung und<br />
Erhaltungszustand des Gebäudes sollen<br />
nicht berücksichtigt werden. Es<br />
werden somit immer eine durchschnittliche<br />
Ausstattung und ein<br />
durchschnittlicher Erhaltungszustand<br />
unterstellt.<br />
• Daten des Immobilienmarktes (z. B.<br />
Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze).<br />
Diese sollen aus den tatsächlichen<br />
Verkaufsfällen über vergleichende<br />
Verfahren abgeleitet werden.<br />
Organisatorisch würden die Grundstücksdaten<br />
von der Vermessungs- und<br />
Katasterverwaltung, die Immobilienmarktdaten<br />
von den Gutachterausschüssen<br />
ermittelt werden. Die Studie<br />
geht davon aus, dass die für die Wertermittlung<br />
benötigten Daten in ausreichender<br />
Qualität und der erforderlichen<br />
Flächendeckung für ganz Deutschland<br />
im Jahre 2012 vorliegen werden.<br />
Die Berechnung des Grundsteuerwertes<br />
soll über ein Rechenprogramm erfolgen,<br />
das Grundstücks- und Immobilienmarktdaten<br />
miteinander verknüpft. Die Wertermittlung<br />
für unbebaute Grundstücke<br />
13