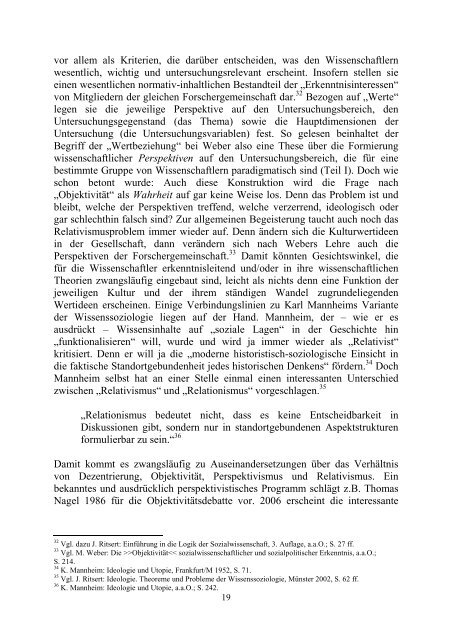Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
vor allem als Kriterien, die darüber entscheiden, was den Wissenschaftlern<br />
wesentlich, wichtig und untersuchungsrelevant erscheint. Insofern stellen sie<br />
einen wesentlichen normativ-inhaltlichen Bestandteil der „Erkenntnisinteressen“<br />
von Mitgliedern der gleichen Forschergemeinschaft dar. 32 Bezogen auf „Werte“<br />
legen sie die jeweilige Perspektive auf den Untersuchungsbereich, den<br />
Untersuchungsgegenstand (das Thema) sowie die Hauptdimensionen der<br />
Untersuchung (die Untersuchungsvariablen) fest. So gelesen beinhaltet der<br />
Begriff der „Wertbeziehung“ bei Weber also eine These über die Formierung<br />
wissenschaftlicher Perspektiven auf den Untersuchungsbereich, die für eine<br />
bestimmte Gruppe von Wissenschaftlern paradigmatisch sind (<strong>Teil</strong> I). Doch wie<br />
schon betont wurde: Auch diese Konstruktion wird die Frage nach<br />
„Objektivität“ als Wahrheit auf gar keine Weise los. Denn das Problem ist und<br />
bleibt, welche der Perspektiven treffend, welche verzerrend, ideologisch oder<br />
gar schlechthin falsch sind? Zur allgemeinen Begeisterung taucht auch noch das<br />
Relativismusproblem immer wieder auf. Denn ändern sich die Kulturwertideen<br />
in der Gesellschaft, dann verändern sich nach Webers Lehre auch die<br />
Perspektiven der Forschergemeinschaft. 33 Damit könnten Gesichtswinkel, die<br />
für die Wissenschaftler erkenntnisleitend und/oder in ihre wissenschaftlichen<br />
Theorien zwangsläufig eingebaut sind, leicht als nichts denn eine Funktion der<br />
jeweiligen Kultur und der ihrem ständigen Wandel zugrundeliegenden<br />
Wertideen erscheinen. Einige Verbindungslinien zu Karl Mannheims Variante<br />
der Wissenssoziologie liegen auf der Hand. Mannheim, der – wie er es<br />
ausdrückt – Wissensinhalte auf „soziale Lagen“ in der Geschichte hin<br />
„funktionalisieren“ will, wurde und wird ja immer wieder als „Relativist“<br />
kritisiert. Denn er will ja die „moderne historistisch-soziologische Einsicht in<br />
die faktische Standortgebundenheit jedes historischen Denkens“ fördern. 34 Doch<br />
Mannheim selbst hat an einer Stelle einmal einen interessanten Unterschied<br />
zwischen „Relativismus“ und „Relationismus“ vorgeschlagen. 35<br />
„Relationismus bedeutet nicht, dass es keine Entscheidbarkeit in<br />
Diskussionen gibt, sondern nur in standortgebundenen Aspektstrukturen<br />
formulierbar zu sein.“ 36<br />
Damit kommt es zwangsläufig zu Auseinandersetzungen über das Verhältnis<br />
von Dezentrierung, Objektivität, Perspektivismus und Relativismus. Ein<br />
bekanntes und ausdrücklich perspektivistisches Programm schlägt z.B. Thomas<br />
Nagel 1986 für die Objektivitätsdebatte vor. 2006 erscheint die interessante<br />
32<br />
Vgl. dazu J. <strong>Ritsert</strong>: Einführung in die Logik der Sozialwissenschaft, 3. Auflage, a.a.O.; S. 27 ff.<br />
33<br />
Vgl. M. Weber: Die >>Objektivität