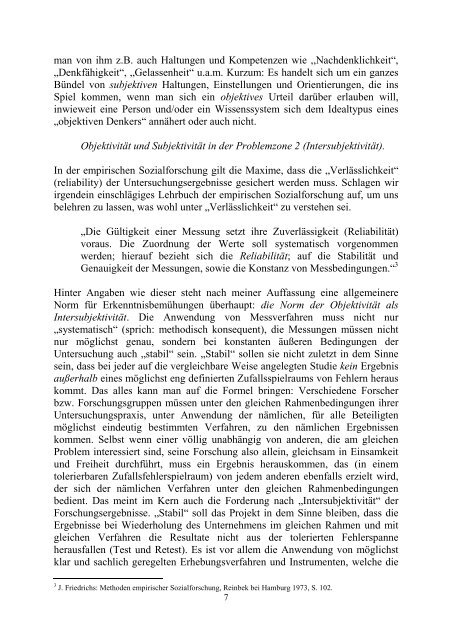Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
man von ihm z.B. auch Haltungen und Kompetenzen wie ,,Nachdenklichkeit“,<br />
„Denkfähigkeit“, „Gelassenheit“ u.a.m. Kurzum: Es handelt sich um ein ganzes<br />
Bündel von subjektiven Haltungen, Einstellungen und Orientierungen, die ins<br />
Spiel kommen, wenn man sich ein objektives Urteil darüber erlauben will,<br />
inwieweit eine Person und/oder ein Wissenssystem sich dem Idealtypus eines<br />
„objektiven Denkers“ annähert oder auch nicht.<br />
Objektivität und Subjektivität in der Problemzone 2 (Intersubjektivität).<br />
In der empirischen Sozialforschung gilt die Maxime, dass die „Verlässlichkeit“<br />
(reliability) der Untersuchungsergebnisse gesichert werden muss. Schlagen wir<br />
irgendein einschlägiges Lehrbuch der empirischen Sozialforschung auf, um uns<br />
belehren zu lassen, was wohl unter „Verlässlichkeit“ zu verstehen sei.<br />
„Die Gültigkeit einer Messung setzt ihre Zuverlässigkeit (Reliabilität)<br />
voraus. Die Zuordnung der Werte soll systematisch vorgenommen<br />
werden; hierauf bezieht sich die Reliabilität; auf die Stabilität und<br />
Genauigkeit der Messungen, sowie die Konstanz von Messbedingungen.“ 3<br />
Hinter Angaben wie dieser steht nach meiner Auffassung eine allgemeinere<br />
Norm für Erkenntnisbemühungen überhaupt: die Norm der Objektivität als<br />
Intersubjektivität. Die Anwendung von Messverfahren muss nicht nur<br />
„systematisch“ (sprich: methodisch konsequent), die Messungen müssen nicht<br />
nur möglichst genau, sondern bei konstanten äußeren Bedingungen der<br />
Untersuchung auch „stabil“ sein. „Stabil“ sollen sie nicht zuletzt in dem Sinne<br />
sein, dass bei jeder auf die vergleichbare Weise angelegten Studie kein Ergebnis<br />
außerhalb eines möglichst eng definierten Zufallsspielraums von Fehlern heraus<br />
kommt. Das alles kann man auf die Formel bringen: Verschiedene Forscher<br />
bzw. Forschungsgruppen müssen unter den gleichen Rahmenbedingungen ihrer<br />
Untersuchungspraxis, unter Anwendung der nämlichen, für alle Beteiligten<br />
möglichst eindeutig bestimmten Verfahren, zu den nämlichen Ergebnissen<br />
kommen. Selbst wenn einer völlig unabhängig von anderen, die am gleichen<br />
Problem interessiert sind, seine Forschung also allein, gleichsam in Einsamkeit<br />
und Freiheit durchführt, muss ein Ergebnis herauskommen, das (in einem<br />
tolerierbaren Zufallsfehlerspielraum) von jedem anderen ebenfalls erzielt wird,<br />
der sich der nämlichen Verfahren unter den gleichen Rahmenbedingungen<br />
bedient. Das meint im Kern auch die Forderung nach „Intersubjektivität“ der<br />
Forschungsergebnisse. „Stabil“ soll das Projekt in dem Sinne bleiben, dass die<br />
Ergebnisse bei Wiederholung des Unternehmens im gleichen Rahmen und mit<br />
gleichen Verfahren die Resultate nicht aus der tolerierten Fehlerspanne<br />
herausfallen (Test und Retest). Es ist vor allem die Anwendung von möglichst<br />
klar und sachlich geregelten Erhebungsverfahren und Instrumenten, welche die<br />
3 J. Friedrichs: Methoden empirischer Sozialforschung, Reinbek bei Hamburg 1973, S. 102.<br />
7