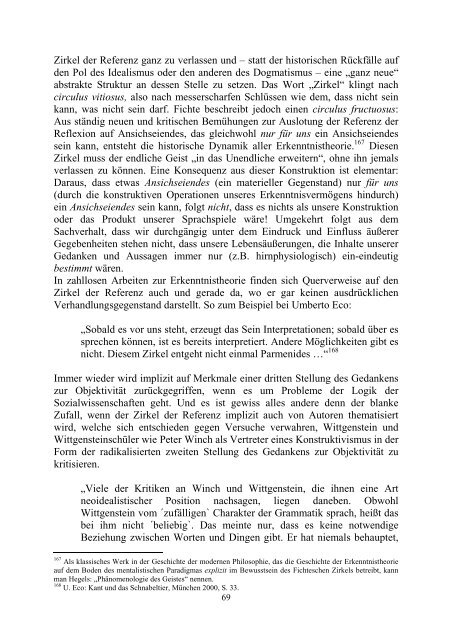Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zirkel der Referenz ganz zu verlassen und – statt der historischen Rückfälle auf<br />
den Pol des Idealismus oder den anderen des Dogmatismus – eine „ganz neue“<br />
abstrakte Struktur an dessen Stelle zu setzen. Das Wort „Zirkel“ klingt nach<br />
circulus vitiosus, also nach messerscharfen Schlüssen wie dem, dass nicht sein<br />
kann, was nicht sein darf. Fichte beschreibt jedoch einen circulus fructuosus:<br />
Aus ständig neuen und kritischen Bemühungen zur Auslotung der Referenz der<br />
Reflexion auf Ansichseiendes, das gleichwohl nur für uns ein Ansichseiendes<br />
sein kann, entsteht die historische Dynamik aller Erkenntnistheorie. 167 Diesen<br />
Zirkel muss der endliche Geist „in das Unendliche erweitern“, ohne ihn jemals<br />
verlassen zu können. Eine Konsequenz aus dieser Konstruktion ist elementar:<br />
Daraus, dass etwas Ansichseiendes (ein materieller Gegenstand) nur für uns<br />
(durch die konstruktiven Operationen unseres Erkenntnisvermögens hindurch)<br />
ein Ansichseiendes sein kann, folgt nicht, dass es nichts als unsere Konstruktion<br />
oder das Produkt unserer Sprachspiele wäre! Umgekehrt folgt aus dem<br />
Sachverhalt, dass wir durchgängig unter dem Eindruck und Einfluss äußerer<br />
Gegebenheiten stehen nicht, dass unsere Lebensäußerungen, die Inhalte unserer<br />
Gedanken und Aussagen immer nur (z.B. hirnphysiologisch) ein-eindeutig<br />
bestimmt wären.<br />
In zahllosen Arbeiten zur Erkenntnistheorie finden sich Querverweise auf den<br />
Zirkel der Referenz auch und gerade da, wo er gar keinen ausdrücklichen<br />
Verhandlungsgegenstand darstellt. So zum Beispiel bei Umberto Eco:<br />
„Sobald es vor uns steht, erzeugt das Sein Interpretationen; sobald über es<br />
sprechen können, ist es bereits interpretiert. Andere Möglichkeiten gibt es<br />
nicht. Diesem Zirkel entgeht nicht einmal Parmenides …“ 168<br />
Immer wieder wird implizit auf Merkmale einer dritten Stellung des Gedankens<br />
zur Objektivität zurückgegriffen, wenn es um Probleme der Logik der<br />
Sozialwissenschaften geht. Und es ist gewiss alles andere denn der blanke<br />
Zufall, wenn der Zirkel der Referenz implizit auch von Autoren thematisiert<br />
wird, welche sich entschieden gegen Versuche verwahren, Wittgenstein und<br />
Wittgensteinschüler wie Peter Winch als Vertreter eines Konstruktivismus in der<br />
Form der radikalisierten zweiten Stellung des Gedankens zur Objektivität zu<br />
kritisieren.<br />
„Viele der Kritiken an Winch und Wittgenstein, die ihnen eine Art<br />
neoidealistischer Position nachsagen, liegen daneben. Obwohl<br />
Wittgenstein vom ´zufälligen` Charakter der Grammatik sprach, heißt das<br />
bei ihm nicht ´beliebig`. Das meinte nur, dass es keine notwendige<br />
Beziehung zwischen Worten und Dingen gibt. Er hat niemals behauptet,<br />
167 Als klassisches Werk in der Geschichte der modernen Philosophie, das die Geschichte der Erkenntnistheorie<br />
auf dem Boden des mentalistischen Paradigmas explizit im Bewusstsein des Fichteschen Zirkels betreibt, kann<br />
man Hegels: „Phänomenologie des Geistes“ nennen.<br />
168 U. Eco: Kant und das Schnabeltier, München 2000, S. 33.<br />
69