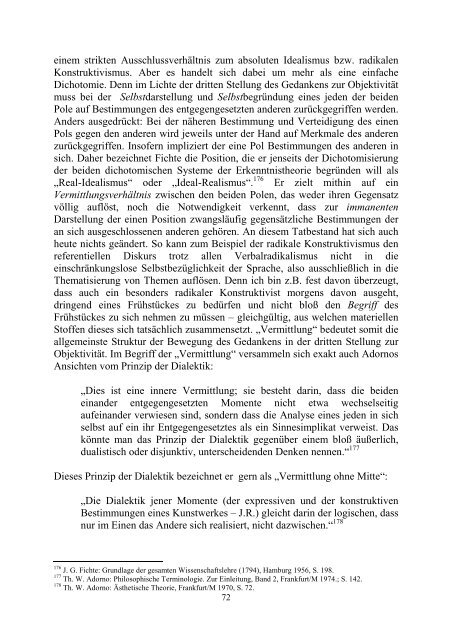Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
einem strikten Ausschlussverhältnis zum absoluten Idealismus bzw. radikalen<br />
Konstruktivismus. Aber es handelt sich dabei um mehr als eine einfache<br />
Dichotomie. Denn im Lichte der dritten Stellung des Gedankens zur Objektivität<br />
muss bei der Selbstdarstellung und Selbstbegründung eines jeden der beiden<br />
Pole auf Bestimmungen des entgegengesetzten anderen zurückgegriffen werden.<br />
Anders ausgedrückt: Bei der näheren Bestimmung und Verteidigung des einen<br />
Pols gegen den anderen wird jeweils unter der Hand auf Merkmale des anderen<br />
zurückgegriffen. Insofern impliziert der eine Pol Bestimmungen des anderen in<br />
sich. Daher bezeichnet Fichte die Position, die er jenseits der Dichotomisierung<br />
der beiden dichotomischen Systeme der Erkenntnistheorie begründen will als<br />
„Real-Idealismus“ oder „Ideal-Realismus“. 176 Er zielt mithin auf ein<br />
Vermittlungsverhältnis zwischen den beiden Polen, das weder ihren Gegensatz<br />
völlig auflöst, noch die Notwendigkeit verkennt, dass zur immanenten<br />
Darstellung der einen Position zwangsläufig gegensätzliche Bestimmungen der<br />
an sich ausgeschlossenen anderen gehören. An diesem Tatbestand hat sich auch<br />
heute nichts geändert. So kann zum Beispiel der radikale Konstruktivismus den<br />
referentiellen Diskurs trotz allen Verbalradikalismus nicht in die<br />
einschränkungslose Selbstbezüglichkeit der Sprache, also ausschließlich in die<br />
Thematisierung von Themen auflösen. Denn ich bin z.B. fest davon überzeugt,<br />
dass auch ein besonders radikaler Konstruktivist morgens davon ausgeht,<br />
dringend eines Frühstückes zu bedürfen und nicht bloß den Begriff des<br />
Frühstückes zu sich nehmen zu müssen – gleichgültig, aus welchen materiellen<br />
Stoffen dieses sich tatsächlich zusammensetzt. „Vermittlung“ bedeutet somit die<br />
allgemeinste Struktur der Bewegung des Gedankens in der dritten Stellung zur<br />
Objektivität. Im Begriff der „Vermittlung“ versammeln sich exakt auch Adornos<br />
Ansichten vom Prinzip der Dialektik:<br />
„Dies ist eine innere Vermittlung; sie besteht darin, dass die beiden<br />
einander entgegengesetzten Momente nicht etwa wechselseitig<br />
aufeinander verwiesen sind, sondern dass die Analyse eines jeden in sich<br />
selbst auf ein ihr Entgegengesetztes als ein Sinnesimplikat verweist. Das<br />
könnte man das Prinzip der Dialektik gegenüber einem bloß äußerlich,<br />
dualistisch oder disjunktiv, unterscheidenden Denken nennen.“ 177<br />
Dieses Prinzip der Dialektik bezeichnet er gern als „Vermittlung ohne Mitte“:<br />
„Die Dialektik jener Momente (der expressiven und der konstruktiven<br />
Bestimmungen eines Kunstwerkes – J.R.) gleicht darin der logischen, dass<br />
nur im Einen das Andere sich realisiert, nicht dazwischen.“ 178<br />
176 J. G. Fichte: Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794), Hamburg 1956, S. 198.<br />
177 Th. W. Adorno: Philosophische Terminologie. Zur Einleitung, Band 2, Frankfurt/M 1974.; S. 142.<br />
178 Th. W. Adorno: Ästhetische Theorie, Frankfurt/M 1970, S. 72.<br />
72