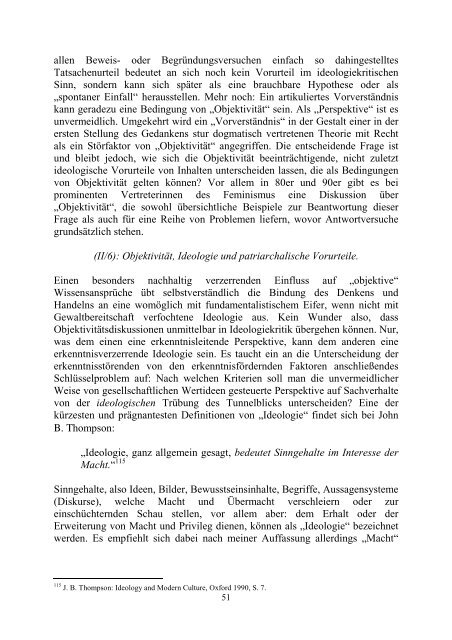Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
allen Beweis- oder Begründungsversuchen einfach so dahingestelltes<br />
Tatsachenurteil bedeutet an sich noch kein Vorurteil im ideologiekritischen<br />
Sinn, sondern kann sich später als eine brauchbare Hypothese oder als<br />
„spontaner Einfall“ herausstellen. Mehr noch: Ein artikuliertes Vorverständnis<br />
kann geradezu eine Bedingung von „Objektivität“ sein. Als „Perspektive“ ist es<br />
unvermeidlich. Umgekehrt wird ein „Vorverständnis“ in der Gestalt einer in der<br />
ersten Stellung des Gedankens stur dogmatisch vertretenen Theorie mit Recht<br />
als ein Störfaktor von „Objektivität“ angegriffen. Die entscheidende Frage ist<br />
und bleibt jedoch, wie sich die Objektivität beeinträchtigende, nicht zuletzt<br />
ideologische Vorurteile von Inhalten unterscheiden lassen, die als Bedingungen<br />
von Objektivität gelten können? Vor allem in 80er und 90er gibt es bei<br />
prominenten Vertreterinnen des Feminismus eine Diskussion über<br />
„Objektivität“, die sowohl übersichtliche Beispiele zur Beantwortung dieser<br />
Frage als auch für eine Reihe von Problemen liefern, wovor Antwortversuche<br />
grundsätzlich stehen.<br />
(<strong>II</strong>/6): Objektivität, Ideologie und patriarchalische Vorurteile.<br />
Einen besonders nachhaltig verzerrenden Einfluss auf „objektive“<br />
Wissensansprüche übt selbstverständlich die Bindung des Denkens und<br />
Handelns an eine womöglich mit fundamentalistischem Eifer, wenn nicht mit<br />
Gewaltbereitschaft verfochtene Ideologie aus. Kein Wunder also, dass<br />
Objektivitätsdiskussionen unmittelbar in Ideologiekritik übergehen können. Nur,<br />
was dem einen eine erkenntnisleitende Perspektive, kann dem anderen eine<br />
erkenntnisverzerrende Ideologie sein. Es taucht ein an die Unterscheidung der<br />
erkenntnisstörenden von den erkenntnisfördernden Faktoren anschließendes<br />
Schlüsselproblem auf: Nach welchen Kriterien soll man die unvermeidlicher<br />
Weise von gesellschaftlichen Wertideen gesteuerte Perspektive auf Sachverhalte<br />
von der ideologischen Trübung des Tunnelblicks unterscheiden? Eine der<br />
kürzesten und prägnantesten Definitionen von „Ideologie“ findet sich bei John<br />
Β. Τhompson:<br />
„Ideologie, ganz allgemein gesagt, bedeutet Sinngehalte im Interesse der<br />
Macht.“ 115<br />
Sinngehalte, also Ideen, Bilder, Bewusstseinsinhalte, Begriffe, Aussagensysteme<br />
(Diskurse), welche Macht und Übermacht verschleiern oder zur<br />
einschüchternden Schau stellen, vor allem aber: dem Erhalt oder der<br />
Erweiterung von Macht und Privileg dienen, können als „Ideologie“ bezeichnet<br />
werden. Es empfiehlt sich dabei nach meiner Auffassung allerdings „Macht“<br />
115 J. B. Thompson: Ideology and Modern Culture, Oxford 1990, S. 7.<br />
51