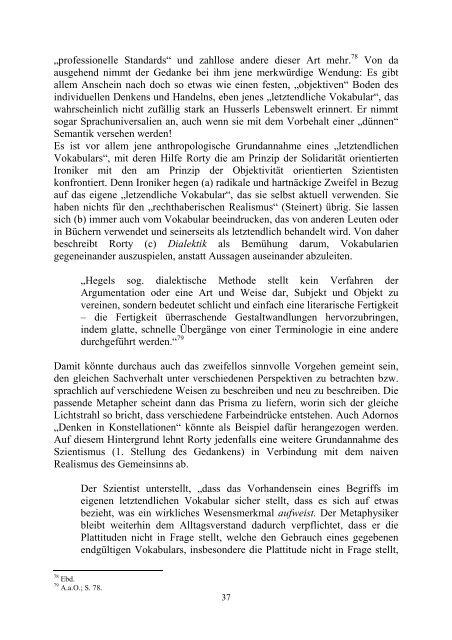Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
„professionelle Standards“ und zahllose andere dieser Art mehr. 78 Von da<br />
ausgehend nimmt der Gedanke bei ihm jene merkwürdige Wendung: Es gibt<br />
allem Anschein nach doch so etwas wie einen festen, „objektiven“ Boden des<br />
individuellen Denkens und Handelns, eben jenes „letztendliche Vokabular“, das<br />
wahrscheinlich nicht zufällig stark an Husserls Lebenswelt erinnert. Er nimmt<br />
sogar Sprachuniversalien an, auch wenn sie mit dem Vorbehalt einer „dünnen“<br />
Semantik versehen werden!<br />
Es ist vor allem jene anthropologische Grundannahme eines „letztendlichen<br />
Vokabulars“, mit deren Hilfe Rorty die am Prinzip der Solidarität orientierten<br />
Ironiker mit den am Prinzip der Objektivität orientierten Szientisten<br />
konfrontiert. Denn Ironiker hegen (a) radikale und hartnäckige Zweifel in Bezug<br />
auf das eigene „letzendliche Vokabular“, das sie selbst aktuell verwenden. Sie<br />
haben nichts für den „rechthaberischen Realismus“ (Steinert) übrig. Sie lassen<br />
sich (b) immer auch vom Vokabular beeindrucken, das von anderen Leuten oder<br />
in Büchern verwendet und seinerseits als letztendlich behandelt wird. Von daher<br />
beschreibt Rorty (c) Dialektik als Bemühung darum, Vokabularien<br />
gegeneinander auszuspielen, anstatt Aussagen auseinander abzuleiten.<br />
„Hegels sog. dialektische Methode stellt kein Verfahren der<br />
Argumentation oder eine Art und Weise dar, Subjekt und Objekt zu<br />
vereinen, sondern bedeutet schlicht und einfach eine literarische Fertigkeit<br />
– die Fertigkeit überraschende Gestaltwandlungen hervorzubringen,<br />
indem glatte, schnelle Übergänge von einer Terminologie in eine andere<br />
durchgeführt werden.“ 79<br />
Damit könnte durchaus auch das zweifellos sinnvolle Vorgehen gemeint sein,<br />
den gleichen Sachverhalt unter verschiedenen Perspektiven zu betrachten bzw.<br />
sprachlich auf verschiedene Weisen zu beschreiben und neu zu beschreiben. Die<br />
passende Metapher scheint dann das Prisma zu liefern, worin sich der gleiche<br />
Lichtstrahl so bricht, dass verschiedene Farbeindrücke entstehen. Auch Adornos<br />
„Denken in Konstellationen“ könnte als Beispiel dafür herangezogen werden.<br />
Auf diesem Hintergrund lehnt Rorty jedenfalls eine weitere Grundannahme des<br />
Szientismus (1. Stellung des Gedankens) in Verbindung mit dem naiven<br />
Realismus des Gemeinsinns ab.<br />
78 Ebd.<br />
79 A.a.O.; S. 78.<br />
Der Szientist unterstellt, „dass das Vorhandensein eines Begriffs im<br />
eigenen letztendlichen Vokabular sicher stellt, dass es sich auf etwas<br />
bezieht, was ein wirkliches Wesensmerkmal aufweist. Der Metaphysiker<br />
bleibt weiterhin dem Alltagsverstand dadurch verpflichtet, dass er die<br />
Plattituden nicht in Frage stellt, welche den Gebrauch eines gegebenen<br />
endgültigen Vokabulars, insbesondere die Plattitude nicht in Frage stellt,<br />
37