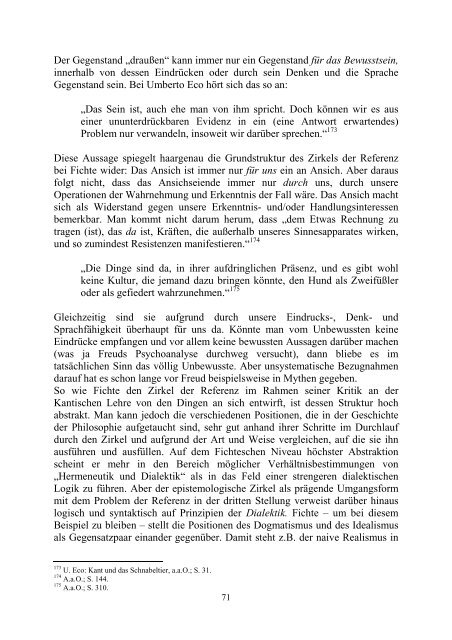Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der Gegenstand „draußen“ kann immer nur ein Gegenstand für das Bewusstsein,<br />
innerhalb von dessen Eindrücken oder durch sein Denken und die Sprache<br />
Gegenstand sein. Bei Umberto Eco hört sich das so an:<br />
„Das Sein ist, auch ehe man von ihm spricht. Doch können wir es aus<br />
einer ununterdrückbaren Evidenz in ein (eine Antwort erwartendes)<br />
Problem nur verwandeln, insoweit wir darüber sprechen.“ 173<br />
Diese Aussage spiegelt haargenau die Grundstruktur des Zirkels der Referenz<br />
bei Fichte wider: Das Ansich ist immer nur für uns ein an Ansich. Aber daraus<br />
folgt nicht, dass das Ansichseiende immer nur durch uns, durch unsere<br />
Operationen der Wahrnehmung und Erkenntnis der Fall wäre. Das Ansich macht<br />
sich als Widerstand gegen unsere Erkenntnis- und/oder Handlungsinteressen<br />
bemerkbar. Man kommt nicht darum herum, dass „dem Etwas Rechnung zu<br />
tragen (ist), das da ist, Kräften, die außerhalb unseres Sinnesapparates wirken,<br />
und so zumindest Resistenzen manifestieren.“ 174<br />
„Die Dinge sind da, in ihrer aufdringlichen Präsenz, und es gibt wohl<br />
keine Kultur, die jemand dazu bringen könnte, den Hund als Zweifüßler<br />
oder als gefiedert wahrzunehmen.“ 175<br />
Gleichzeitig sind sie aufgrund durch unsere Eindrucks-, Denk- und<br />
Sprachfähigkeit überhaupt für uns da. Könnte man vom Unbewussten keine<br />
Eindrücke empfangen und vor allem keine bewussten Aussagen darüber machen<br />
(was ja Freuds Psychoanalyse durchweg versucht), dann bliebe es im<br />
tatsächlichen Sinn das völlig Unbewusste. Aber unsystematische Bezugnahmen<br />
darauf hat es schon lange vor Freud beispielsweise in Mythen gegeben.<br />
So wie Fichte den Zirkel der Referenz im Rahmen seiner Kritik an der<br />
Kantischen Lehre von den Dingen an sich entwirft, ist dessen Struktur hoch<br />
abstrakt. Man kann jedoch die verschiedenen Positionen, die in der Geschichte<br />
der Philosophie aufgetaucht sind, sehr gut anhand ihrer Schritte im Durchlauf<br />
durch den Zirkel und aufgrund der Art und Weise vergleichen, auf die sie ihn<br />
ausführen und ausfüllen. Auf dem Fichteschen Niveau höchster Abstraktion<br />
scheint er mehr in den Bereich möglicher Verhältnisbestimmungen von<br />
„Hermeneutik und Dialektik“ als in das Feld einer strengeren dialektischen<br />
Logik zu führen. Aber der epistemologische Zirkel als prägende Umgangsform<br />
mit dem Problem der Referenz in der dritten Stellung verweist darüber hinaus<br />
logisch und syntaktisch auf Prinzipien der Dialektik. Fichte – um bei diesem<br />
Beispiel zu bleiben – stellt die Positionen des Dogmatismus und des Idealismus<br />
als Gegensatzpaar einander gegenüber. Damit steht z.B. der naive Realismus in<br />
173 U. Eco: Kant und das Schnabeltier, a.a.O.; S. 31.<br />
174 A.a.O.; S. 144.<br />
175 A.a.O.; S. 310.<br />
71