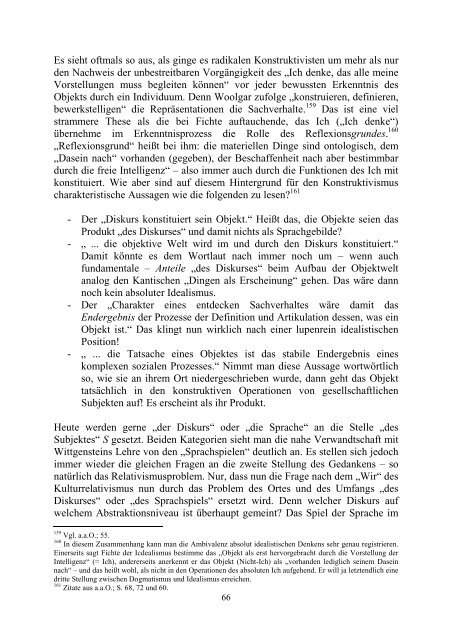Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Es sieht oftmals so aus, als ginge es radikalen Konstruktivisten um mehr als nur<br />
den Nachweis der unbestreitbaren Vorgängigkeit des „Ich denke, das alle meine<br />
Vorstellungen muss begleiten können“ vor jeder bewussten Erkenntnis des<br />
Objekts durch ein Individuum. Denn Woolgar zufolge „konstruieren, definieren,<br />
bewerkstelligen“ die Repräsentationen die Sachverhalte. 159 Das ist eine viel<br />
strammere These als die bei Fichte auftauchende, das Ich („Ich denke“)<br />
übernehme im Erkenntnisprozess die Rolle des Reflexionsgrundes. 160<br />
„Reflexionsgrund“ heißt bei ihm: die materiellen Dinge sind ontologisch, dem<br />
„Dasein nach“ vorhanden (gegeben), der Beschaffenheit nach aber bestimmbar<br />
durch die freie Intelligenz“ – also immer auch durch die Funktionen des Ich mit<br />
konstituiert. Wie aber sind auf diesem Hintergrund für den Konstruktivismus<br />
charakteristische Aussagen wie die folgenden zu lesen? 161<br />
- Der „Diskurs konstituiert sein Objekt.“ Heißt das, die Objekte seien das<br />
Produkt „des Diskurses“ und damit nichts als Sprachgebilde?<br />
- „ ... die objektive Welt wird im und durch den Diskurs konstituiert.“<br />
Damit könnte es dem Wortlaut nach immer noch um – wenn auch<br />
fundamentale – Anteile „des Diskurses“ beim Aufbau der Objektwelt<br />
analog den Kantischen „Dingen als Erscheinung“ gehen. Das wäre dann<br />
noch kein absoluter Idealismus.<br />
- Der „Charakter eines entdecken Sachverhaltes wäre damit das<br />
Endergebnis der Prozesse der Definition und Artikulation dessen, was ein<br />
Objekt ist.“ Das klingt nun wirklich nach einer lupenrein idealistischen<br />
Position!<br />
- „ ... die Tatsache eines Objektes ist das stabile Endergebnis eines<br />
komplexen sozialen Prozesses.“ Nimmt man diese Aussage wortwörtlich<br />
so, wie sie an ihrem Ort niedergeschrieben wurde, dann geht das Objekt<br />
tatsächlich in den konstruktiven Operationen von gesellschaftlichen<br />
Subjekten auf! Es erscheint als ihr Produkt.<br />
Heute werden gerne „der Diskurs“ oder „die Sprache“ an die Stelle „des<br />
Subjektes“ S gesetzt. Beiden Kategorien sieht man die nahe Verwandtschaft mit<br />
Wittgensteins Lehre von den „Sprachspielen“ deutlich an. Es stellen sich jedoch<br />
immer wieder die gleichen Fragen an die zweite Stellung des Gedankens – so<br />
natürlich das Relativismusproblem. Nur, dass nun die Frage nach dem „Wir“ des<br />
Kulturrelativismus nun durch das Problem des Ortes und des Umfangs „des<br />
Diskurses“ oder „des Sprachspiels“ ersetzt wird. Denn welcher Diskurs auf<br />
welchem Abstraktionsniveau ist überhaupt gemeint? Das Spiel der Sprache im<br />
159 Vgl. a.a.O.; 55.<br />
160 In diesem Zusammenhang kann man die Ambivalenz absolut idealistischen Denkens sehr genau registrieren.<br />
Einerseits sagt Fichte der Icdealismus bestimme das „Objekt als erst hervorgebracht durch die Vorstellung der<br />
Intelligenz“ (= Ich), andererseits anerkennt er das Objekt (Nicht-Ich) als „vorhanden lediglich seinem Dasein<br />
nach“ – und das heißt wohl, als nicht in den Operationen des absoluten Ich aufgehend. Er will ja letztendlich eine<br />
dritte Stellung zwischen Dogmatismus und Idealismus erreichen.<br />
161 Zitate aus a.a.O.; S. 68, 72 und 60.<br />
66