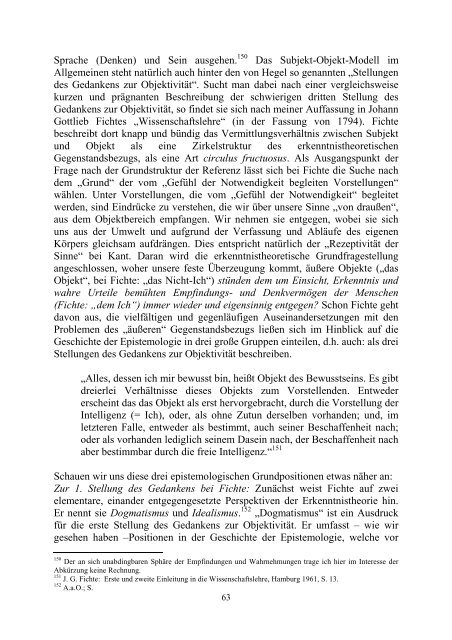Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sprache (Denken) und Sein ausgehen. 150 Das Subjekt-Objekt-Modell im<br />
Allgemeinen steht natürlich auch hinter den von Hegel so genannten „Stellungen<br />
des Gedankens zur Objektivität“. Sucht man dabei nach einer vergleichsweise<br />
kurzen und prägnanten Beschreibung der schwierigen dritten Stellung des<br />
Gedankens zur Objektivität, so findet sie sich nach meiner Auffassung in Johann<br />
Gottlieb Fichtes „Wissenschaftslehre“ (in der Fassung von 1794). Fichte<br />
beschreibt dort knapp und bündig das Vermittlungsverhältnis zwischen Subjekt<br />
und Objekt als eine Zirkelstruktur des erkenntnistheoretischen<br />
Gegenstandsbezugs, als eine Art circulus fructuosus. Als Ausgangspunkt der<br />
Frage nach der Grundstruktur der Referenz lässt sich bei Fichte die Suche nach<br />
dem „Grund“ der vom „Gefühl der Notwendigkeit begleiten Vorstellungen“<br />
wählen. Unter Vorstellungen, die vom „Gefühl der Notwendigkeit“ begleitet<br />
werden, sind Eindrücke zu verstehen, die wir über unsere Sinne „von draußen“,<br />
aus dem Objektbereich empfangen. Wir nehmen sie entgegen, wobei sie sich<br />
uns aus der Umwelt und aufgrund der Verfassung und Abläufe des eigenen<br />
Körpers gleichsam aufdrängen. Dies entspricht natürlich der „Rezeptivität der<br />
Sinne“ bei Kant. Daran wird die erkenntnistheoretische Grundfragestellung<br />
angeschlossen, woher unsere feste Überzeugung kommt, äußere Objekte („das<br />
Objekt“, bei Fichte: „das Nicht-Ich“) stünden dem um Einsicht, Erkenntnis und<br />
wahre Urteile bemühten Empfindungs- und Denkvermögen der Menschen<br />
(Fichte: „dem Ich“) immer wieder und eigensinnig entgegen? Schon Fichte geht<br />
davon aus, die vielfältigen und gegenläufigen Auseinandersetzungen mit den<br />
Problemen des „äußeren“ Gegenstandsbezugs ließen sich im Hinblick auf die<br />
Geschichte der Epistemologie in drei große Gruppen einteilen, d.h. auch: als drei<br />
Stellungen des Gedankens zur Objektivität beschreiben.<br />
„Alles, dessen ich mir bewusst bin, heißt Objekt des Bewusstseins. Es gibt<br />
dreierlei Verhältnisse dieses Objekts zum Vorstellenden. Entweder<br />
erscheint das das Objekt als erst hervorgebracht, durch die Vorstellung der<br />
Intelligenz (= Ich), oder, als ohne Zutun derselben vorhanden; und, im<br />
letzteren Falle, entweder als bestimmt, auch seiner Beschaffenheit nach;<br />
oder als vorhanden lediglich seinem Dasein nach, der Beschaffenheit nach<br />
aber bestimmbar durch die freie Intelligenz.“ 151<br />
Schauen wir uns diese drei epistemologischen Grundpositionen etwas näher an:<br />
Zur 1. Stellung des Gedankens bei Fichte: Zunächst weist Fichte auf zwei<br />
elementare, einander entgegengesetzte Perspektiven der Erkenntnistheorie hin.<br />
Er nennt sie Dogmatismus und Idealismus. 152 „Dogmatismus“ ist ein Ausdruck<br />
für die erste Stellung des Gedankens zur Objektivität. Er umfasst – wie wir<br />
gesehen haben –Positionen in der Geschichte der Epistemologie, welche vor<br />
150<br />
Der an sich unabdingbaren Sphäre der Empfindungen und Wahrnehmungen trage ich hier im Interesse der<br />
Abkürzung keine Rechnung.<br />
151<br />
J. G. Fichte: Erste und zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, Hamburg 1961, S. 13.<br />
152 A.a.O.; S.<br />
63