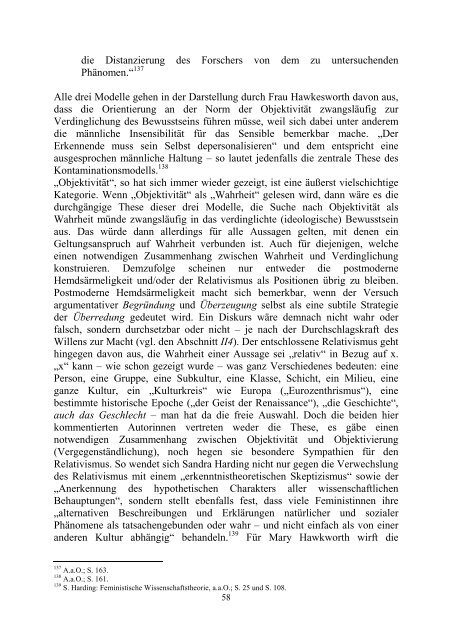Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
die Distanzierung des Forschers von dem zu untersuchenden<br />
Phänomen.“ 137<br />
Alle drei Modelle gehen in der Darstellung durch Frau Hawkesworth davon aus,<br />
dass die Orientierung an der Norm der Objektivität zwangsläufig zur<br />
Verdinglichung des Bewusstseins führen müsse, weil sich dabei unter anderem<br />
die männliche Insensibilität für das Sensible bemerkbar mache. „Der<br />
Erkennende muss sein Selbst depersonalisieren“ und dem entspricht eine<br />
ausgesprochen männliche Haltung – so lautet jedenfalls die zentrale These des<br />
Kontaminationsmodells. 138<br />
„Objektivität“, so hat sich immer wieder gezeigt, ist eine äußerst vielschichtige<br />
Kategorie. Wenn „Objektivität“ als „Wahrheit“ gelesen wird, dann wäre es die<br />
durchgängige These dieser drei Modelle, die Suche nach Objektivität als<br />
Wahrheit münde zwangsläufig in das verdinglichte (ideologische) Bewusstsein<br />
aus. Das würde dann allerdings für alle Aussagen gelten, mit denen ein<br />
Geltungsanspruch auf Wahrheit verbunden ist. Auch für diejenigen, welche<br />
einen notwendigen Zusammenhang zwischen Wahrheit und Verdinglichung<br />
konstruieren. Demzufolge scheinen nur entweder die postmoderne<br />
Hemdsärmeligkeit und/oder der Relativismus als Positionen übrig zu bleiben.<br />
Postmoderne Hemdsärmeligkeit macht sich bemerkbar, wenn der Versuch<br />
argumentativer Begründung und Überzeugung selbst als eine subtile Strategie<br />
der Überredung gedeutet wird. Ein Diskurs wäre demnach nicht wahr oder<br />
falsch, sondern durchsetzbar oder nicht – je nach der Durchschlagskraft des<br />
Willens zur Macht (vgl. den Abschnitt <strong>II</strong>4). Der entschlossene Relativismus geht<br />
hingegen davon aus, die Wahrheit einer Aussage sei „relativ“ in Bezug auf x.<br />
„x“ kann – wie schon gezeigt wurde – was ganz Verschiedenes bedeuten: eine<br />
Person, eine Gruppe, eine Subkultur, eine Klasse, Schicht, ein Milieu, eine<br />
ganze Kultur, ein „Kulturkreis“ wie Europa („Eurozenthrismus“), eine<br />
bestimmte historische Epoche („der Geist der Renaissance“), „die Geschichte“,<br />
auch das Geschlecht – man hat da die freie Auswahl. Doch die beiden hier<br />
kommentierten Autorinnen vertreten weder die These, es gäbe einen<br />
notwendigen Zusammenhang zwischen Objektivität und Objektivierung<br />
(Vergegenständlichung), noch hegen sie besondere Sympathien für den<br />
Relativismus. So wendet sich Sandra Harding nicht nur gegen die Verwechslung<br />
des Relativismus mit einem „erkenntnistheoretischen Skeptizismus“ sowie der<br />
„Anerkennung des hypothetischen Charakters aller wissenschaftlichen<br />
Behauptungen“, sondern stellt ebenfalls fest, dass viele Feministinnen ihre<br />
„alternativen Beschreibungen und Erklärungen natürlicher und sozialer<br />
Phänomene als tatsachengebunden oder wahr – und nicht einfach als von einer<br />
anderen Kultur abhängig“ behandeln. 139 Für Mary Hawkworth wirft die<br />
137 A.a.O.; S. 163.<br />
138 A.a.O.; S. 161.<br />
139 S. Harding: Feministische Wissenschaftstheorie, a.a.O.; S. 25 und S. 108.<br />
58