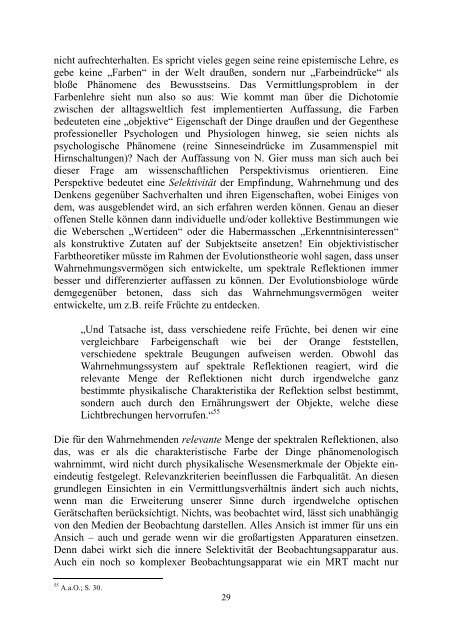Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
nicht aufrechterhalten. Es spricht vieles gegen seine reine epistemische Lehre, es<br />
gebe keine „Farben“ in der Welt draußen, sondern nur „Farbeindrücke“ als<br />
bloße Phänomene des Bewusstseins. Das Vermittlungsproblem in der<br />
Farbenlehre sieht nun also so aus: Wie kommt man über die Dichotomie<br />
zwischen der alltagsweltlich fest implementierten Auffassung, die Farben<br />
bedeuteten eine „objektive“ Eigenschaft der Dinge draußen und der Gegenthese<br />
professioneller Psychologen und Physiologen hinweg, sie seien nichts als<br />
psychologische Phänomene (reine Sinneseindrücke im Zusammenspiel mit<br />
Hirnschaltungen)? Nach der Auffassung von N. Gier muss man sich auch bei<br />
dieser Frage am wissenschaftlichen Perspektivismus orientieren. Eine<br />
Perspektive bedeutet eine Selektivität der Empfindung, Wahrnehmung und des<br />
Denkens gegenüber Sachverhalten und ihren Eigenschaften, wobei Einiges von<br />
dem, was ausgeblendet wird, an sich erfahren werden können. Genau an dieser<br />
offenen Stelle können dann individuelle und/oder kollektive Bestimmungen wie<br />
die Weberschen „Wertideen“ oder die Habermasschen „Erkenntnisinteressen“<br />
als konstruktive Zutaten auf der Subjektseite ansetzen! Ein objektivistischer<br />
Farbtheoretiker müsste im Rahmen der Evolutionstheorie wohl sagen, dass unser<br />
Wahrnehmungsvermögen sich entwickelte, um spektrale Reflektionen immer<br />
besser und differenzierter auffassen zu können. Der Evolutionsbiologe würde<br />
demgegenüber betonen, dass sich das Wahrnehmungsvermögen weiter<br />
entwickelte, um z.B. reife Früchte zu entdecken.<br />
„Und Tatsache ist, dass verschiedene reife Früchte, bei denen wir eine<br />
vergleichbare Farbeigenschaft wie bei der Orange feststellen,<br />
verschiedene spektrale Beugungen aufweisen werden. Obwohl das<br />
Wahrnehmungssystem auf spektrale Reflektionen reagiert, wird die<br />
relevante Menge der Reflektionen nicht durch irgendwelche ganz<br />
bestimmte physikalische Charakteristika der Reflektion selbst bestimmt,<br />
sondern auch durch den Ernährungswert der Objekte, welche diese<br />
Lichtbrechungen hervorrufen.“ 55<br />
Die für den Wahrnehmenden relevante Menge der spektralen Reflektionen, also<br />
das, was er als die charakteristische Farbe der Dinge phänomenologisch<br />
wahrnimmt, wird nicht durch physikalische Wesensmerkmale der Objekte eineindeutig<br />
festgelegt. Relevanzkriterien beeinflussen die Farbqualität. An diesen<br />
grundlegen Einsichten in ein Vermittlungsverhältnis ändert sich auch nichts,<br />
wenn man die Erweiterung unserer Sinne durch irgendwelche optischen<br />
Gerätschaften berücksichtigt. Nichts, was beobachtet wird, lässt sich unabhängig<br />
von den Medien der Beobachtung darstellen. Alles Ansich ist immer für uns ein<br />
Ansich – auch und gerade wenn wir die großartigsten Apparaturen einsetzen.<br />
Denn dabei wirkt sich die innere Selektivität der Beobachtungsapparatur aus.<br />
Auch ein noch so komplexer Beobachtungsapparat wie ein MRT macht nur<br />
55 A.a.O.; S. 30.<br />
29