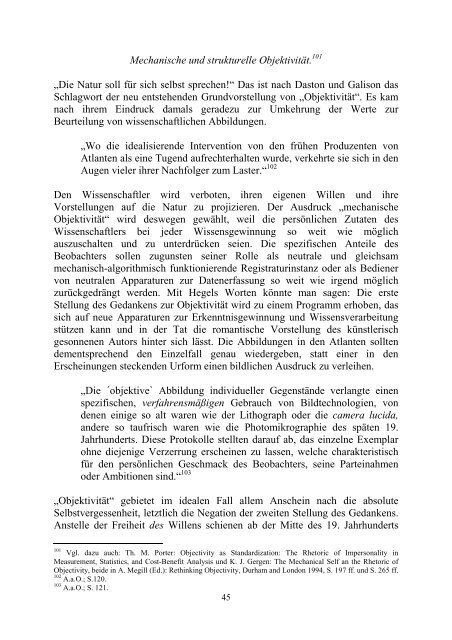Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mechanische und strukturelle Objektivität. 101<br />
„Die Natur soll für sich selbst sprechen!“ Das ist nach Daston und Galison das<br />
Schlagwort der neu entstehenden Grundvorstellung von „Objektivität“. Es kam<br />
nach ihrem Eindruck damals geradezu zur Umkehrung der Werte zur<br />
Beurteilung von wissenschaftlichen Abbildungen.<br />
„Wo die idealisierende Intervention von den frühen Produzenten von<br />
Atlanten als eine Tugend aufrechterhalten wurde, verkehrte sie sich in den<br />
Augen vieler ihrer Nachfolger zum Laster.“ 102<br />
Den Wissenschaftler wird verboten, ihren eigenen Willen und ihre<br />
Vorstellungen auf die Natur zu projizieren. Der Ausdruck „mechanische<br />
Objektivität“ wird deswegen gewählt, weil die persönlichen Zutaten des<br />
Wissenschaftlers bei jeder Wissensgewinnung so weit wie möglich<br />
auszuschalten und zu unterdrücken seien. Die spezifischen Anteile des<br />
Beobachters sollen zugunsten seiner Rolle als neutrale und gleichsam<br />
mechanisch-algorithmisch funktionierende Registraturinstanz oder als Bediener<br />
von neutralen Apparaturen zur Datenerfassung so weit wie irgend möglich<br />
zurückgedrängt werden. Mit Hegels Worten könnte man sagen: Die erste<br />
Stellung des Gedankens zur Objektivität wird zu einem Programm erhoben, das<br />
sich auf neue Apparaturen zur Erkenntnisgewinnung und Wissensverarbeitung<br />
stützen kann und in der Tat die romantische Vorstellung des künstlerisch<br />
gesonnenen Autors hinter sich lässt. Die Abbildungen in den Atlanten sollten<br />
dementsprechend den Einzelfall genau wiedergeben, statt einer in den<br />
Erscheinungen steckenden Urform einen bildlichen Ausdruck zu verleihen.<br />
„Die ´objektive` Abbildung individueller Gegenstände verlangte einen<br />
spezifischen, verfahrensmäßigen Gebrauch von Bildtechnologien, von<br />
denen einige so alt waren wie der Lithograph oder die camera lucida,<br />
andere so taufrisch waren wie die Photomikrographie des späten 19.<br />
Jahrhunderts. Diese Protokolle stellten darauf ab, das einzelne Exemplar<br />
ohne diejenige Verzerrung erscheinen zu lassen, welche charakteristisch<br />
für den persönlichen Geschmack des Beobachters, seine Parteinahmen<br />
oder Ambitionen sind.“ 103<br />
„Objektivität“ gebietet im idealen Fall allem Anschein nach die absolute<br />
Selbstvergessenheit, letztlich die Negation der zweiten Stellung des Gedankens.<br />
Anstelle der Freiheit des Willens schienen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
101 Vgl. dazu auch: Th. M. Porter: Objectivity as Standardization: The Rhetoric of Impersonality in<br />
Measurement, Statistics, and Cost-Benefit Analysis und K. J. Gergen: The Mechanical Self an the Rhetoric of<br />
Objectivity, beide in A. Megill (Ed.): Rethinking Objectivity, Durham and London 1994, S. 197 ff. und S. 265 ff.<br />
102 A.a.O.; S.120.<br />
103 A.a.O.; S. 121.<br />
45