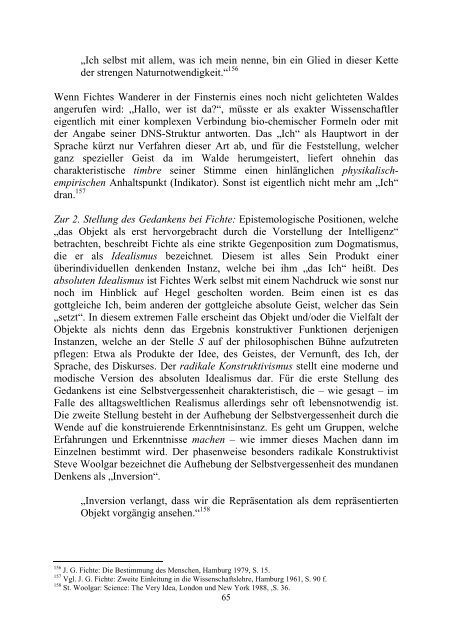Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
„Ich selbst mit allem, was ich mein nenne, bin ein Glied in dieser Kette<br />
der strengen Naturnotwendigkeit.“ 156<br />
Wenn Fichtes Wanderer in der Finsternis eines noch nicht gelichteten Waldes<br />
angerufen wird: „Hallo, wer ist da?“, müsste er als exakter Wissenschaftler<br />
eigentlich mit einer komplexen Verbindung bio-chemischer Formeln oder mit<br />
der Angabe seiner DNS-Struktur antworten. Das „Ich“ als Hauptwort in der<br />
Sprache kürzt nur Verfahren dieser Art ab, und für die Feststellung, welcher<br />
ganz spezieller Geist da im Walde herumgeistert, liefert ohnehin das<br />
charakteristische timbre seiner Stimme einen hinlänglichen physikalischempirischen<br />
Anhaltspunkt (Indikator). Sonst ist eigentlich nicht mehr am „Ich“<br />
dran. 157<br />
Zur 2. Stellung des Gedankens bei Fichte: Epistemologische Positionen, welche<br />
„das Objekt als erst hervorgebracht durch die Vorstellung der Intelligenz“<br />
betrachten, beschreibt Fichte als eine strikte Gegenposition zum Dogmatismus,<br />
die er als Idealismus bezeichnet. Diesem ist alles Sein Produkt einer<br />
überindividuellen denkenden Instanz, welche bei ihm „das Ich“ heißt. Des<br />
absoluten Idealismus ist Fichtes Werk selbst mit einem Nachdruck wie sonst nur<br />
noch im Hinblick auf Hegel gescholten worden. Beim einen ist es das<br />
gottgleiche Ich, beim anderen der gottgleiche absolute Geist, welcher das Sein<br />
„setzt“. In diesem extremen Falle erscheint das Objekt und/oder die Vielfalt der<br />
Objekte als nichts denn das Ergebnis konstruktiver Funktionen derjenigen<br />
Instanzen, welche an der Stelle S auf der philosophischen Bühne aufzutreten<br />
pflegen: Etwa als Produkte der Idee, des Geistes, der Vernunft, des Ich, der<br />
Sprache, des Diskurses. Der radikale Konstruktivismus stellt eine moderne und<br />
modische Version des absoluten Idealismus dar. Für die erste Stellung des<br />
Gedankens ist eine Selbstvergessenheit charakteristisch, die – wie gesagt – im<br />
Falle des alltagsweltlichen Realismus allerdings sehr oft lebensnotwendig ist.<br />
Die zweite Stellung besteht in der Aufhebung der Selbstvergessenheit durch die<br />
Wende auf die konstruierende Erkenntnisinstanz. Es geht um Gruppen, welche<br />
Erfahrungen und Erkenntnisse machen – wie immer dieses Machen dann im<br />
Einzelnen bestimmt wird. Der phasenweise besonders radikale Konstruktivist<br />
Steve Woolgar bezeichnet die Aufhebung der Selbstvergessenheit des mundanen<br />
Denkens als „Inversion“.<br />
„Inversion verlangt, dass wir die Repräsentation als dem repräsentierten<br />
Objekt vorgängig ansehen.“ 158<br />
156 J. G. Fichte: Die Bestimmung des Menschen, Hamburg 1979, S. 15.<br />
157 Vgl. J. G. Fichte: Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, Hamburg 1961, S. 90 f.<br />
158 St. Woolgar: Science: The Very Idea, London und New York 1988, ,S. 36.<br />
65