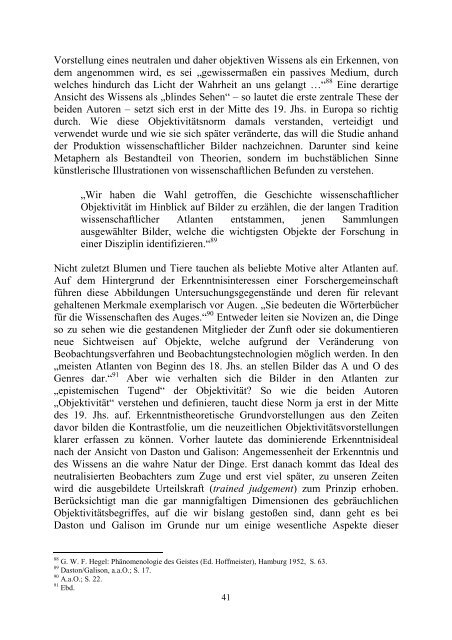Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorstellung eines neutralen und daher objektiven Wissens als ein Erkennen, von<br />
dem angenommen wird, es sei „gewissermaßen ein passives Medium, durch<br />
welches hindurch das Licht der Wahrheit an uns gelangt …“ 88 Eine derartige<br />
Ansicht des Wissens als „blindes Sehen“ – so lautet die erste zentrale These der<br />
beiden Autoren – setzt sich erst in der Mitte des 19. Jhs. in Europa so richtig<br />
durch. Wie diese Objektivitätsnorm damals verstanden, verteidigt und<br />
verwendet wurde und wie sie sich später veränderte, das will die Studie anhand<br />
der Produktion wissenschaftlicher Bilder nachzeichnen. Darunter sind keine<br />
Metaphern als Bestandteil von Theorien, sondern im buchstäblichen Sinne<br />
künstlerische Illustrationen von wissenschaftlichen Befunden zu verstehen.<br />
„Wir haben die Wahl getroffen, die Geschichte wissenschaftlicher<br />
Objektivität im Hinblick auf Bilder zu erzählen, die der langen Tradition<br />
wissenschaftlicher Atlanten entstammen, jenen Sammlungen<br />
ausgewählter Bilder, welche die wichtigsten Objekte der Forschung in<br />
einer Disziplin identifizieren.“ 89<br />
Nicht zuletzt Blumen und Tiere tauchen als beliebte Motive alter Atlanten auf.<br />
Auf dem Hintergrund der Erkenntnisinteressen einer Forschergemeinschaft<br />
führen diese Abbildungen Untersuchungsgegenstände und deren für relevant<br />
gehaltenen Merkmale exemplarisch vor Augen. „Sie bedeuten die Wörterbücher<br />
für die Wissenschaften des Auges.“ 90 Entweder leiten sie Novizen an, die Dinge<br />
so zu sehen wie die gestandenen Mitglieder der Zunft oder sie dokumentieren<br />
neue Sichtweisen auf Objekte, welche aufgrund der Veränderung von<br />
Beobachtungsverfahren und Beobachtungstechnologien möglich werden. In den<br />
„meisten Atlanten von Beginn des 18. Jhs. an stellen Bilder das A und O des<br />
Genres dar.“ 91 Aber wie verhalten sich die Bilder in den Atlanten zur<br />
„epistemischen Tugend“ der Objektivität? So wie die beiden Autoren<br />
„Objektivität“ verstehen und definieren, taucht diese Norm ja erst in der Mitte<br />
des 19. Jhs. auf. Erkenntnistheoretische Grundvorstellungen aus den Zeiten<br />
davor bilden die Kontrastfolie, um die neuzeitlichen Objektivitätsvorstellungen<br />
klarer erfassen zu können. Vorher lautete das dominierende Erkenntnisideal<br />
nach der Ansicht von Daston und Galison: Angemessenheit der Erkenntnis und<br />
des Wissens an die wahre Natur der Dinge. Erst danach kommt das Ideal des<br />
neutralisierten Beobachters zum Zuge und erst viel später, zu unseren Zeiten<br />
wird die ausgebildete Urteilskraft (trained judgement) zum Prinzip erhoben.<br />
Berücksichtigt man die gar mannigfaltigen Dimensionen des gebräuchlichen<br />
Objektivitätsbegriffes, auf die wir bislang gestoßen sind, dann geht es bei<br />
Daston und Galison im Grunde nur um einige wesentliche Aspekte dieser<br />
88 G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes (Ed. Hoffmeister), Hamburg 1952, S. 63.<br />
89 Daston/Galison, a.a.O.; S. 17.<br />
90 A.a.O.; S. 22.<br />
91 Ebd.<br />
41