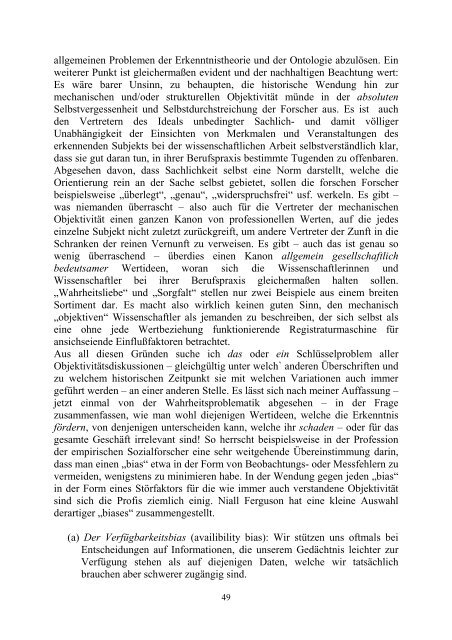Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
allgemeinen Problemen der Erkenntnistheorie und der Ontologie abzulösen. Ein<br />
weiterer Punkt ist gleichermaßen evident und der nachhaltigen Beachtung wert:<br />
Es wäre barer Unsinn, zu behaupten, die historische Wendung hin zur<br />
mechanischen und/oder strukturellen Objektivität münde in der absoluten<br />
Selbstvergessenheit und Selbstdurchstreichung der Forscher aus. Es ist auch<br />
den Vertretern des Ideals unbedingter Sachlich- und damit völliger<br />
Unabhängigkeit der Einsichten von Merkmalen und Veranstaltungen des<br />
erkennenden Subjekts bei der wissenschaftlichen Arbeit selbstverständlich klar,<br />
dass sie gut daran tun, in ihrer Berufspraxis bestimmte Tugenden zu offenbaren.<br />
Abgesehen davon, dass Sachlichkeit selbst eine Norm darstellt, welche die<br />
Orientierung rein an der Sache selbst gebietet, sollen die forschen Forscher<br />
beispielsweise „überlegt“, „genau“, „widerspruchsfrei“ usf. werkeln. Es gibt –<br />
was niemanden überrascht – also auch für die Vertreter der mechanischen<br />
Objektivität einen ganzen Kanon von professionellen Werten, auf die jedes<br />
einzelne Subjekt nicht zuletzt zurückgreift, um andere Vertreter der Zunft in die<br />
Schranken der reinen Vernunft zu verweisen. Es gibt – auch das ist genau so<br />
wenig überraschend – überdies einen Kanon allgemein gesellschaftlich<br />
bedeutsamer Wertideen, woran sich die Wissenschaftlerinnen und<br />
Wissenschaftler bei ihrer Berufspraxis gleichermaßen halten sollen.<br />
„Wahrheitsliebe“ und „Sorgfalt“ stellen nur zwei Beispiele aus einem breiten<br />
Sortiment dar. Es macht also wirklich keinen guten Sinn, den mechanisch<br />
„objektiven“ Wissenschaftler als jemanden zu beschreiben, der sich selbst als<br />
eine ohne jede Wertbeziehung funktionierende Registraturmaschine für<br />
ansichseiende Einflußfaktoren betrachtet.<br />
Aus all diesen Gründen suche ich das oder ein Schlüsselproblem aller<br />
Objektivitätsdiskussionen – gleichgültig unter welch` anderen Überschriften und<br />
zu welchem historischen Zeitpunkt sie mit welchen Variationen auch immer<br />
geführt werden – an einer anderen Stelle. Es lässt sich nach meiner Auffassung –<br />
jetzt einmal von der Wahrheitsproblematik abgesehen – in der Frage<br />
zusammenfassen, wie man wohl diejenigen Wertideen, welche die Erkenntnis<br />
fördern, von denjenigen unterscheiden kann, welche ihr schaden – oder für das<br />
gesamte Geschäft irrelevant sind! So herrscht beispielsweise in der Profession<br />
der empirischen Sozialforscher eine sehr weitgehende Übereinstimmung darin,<br />
dass man einen „bias“ etwa in der Form von Beobachtungs- oder Messfehlern zu<br />
vermeiden, wenigstens zu minimieren habe. In der Wendung gegen jeden „bias“<br />
in der Form eines Störfaktors für die wie immer auch verstandene Objektivität<br />
sind sich die Profis ziemlich einig. Niall Ferguson hat eine kleine Auswahl<br />
derartiger „biases“ zusammengestellt.<br />
(a) Der Verfügbarkeitsbias (availibility bias): Wir stützen uns oftmals bei<br />
Entscheidungen auf Informationen, die unserem Gedächtnis leichter zur<br />
Verfügung stehen als auf diejenigen Daten, welche wir tatsächlich<br />
brauchen aber schwerer zugängig sind.<br />
49