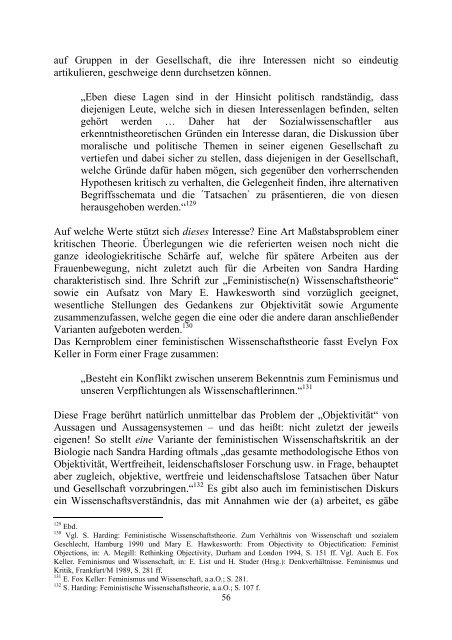Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Teil II - Jürgen Ritsert
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
auf Gruppen in der Gesellschaft, die ihre Interessen nicht so eindeutig<br />
artikulieren, geschweige denn durchsetzen können.<br />
„Eben diese Lagen sind in der Hinsicht politisch randständig, dass<br />
diejenigen Leute, welche sich in diesen Interessenlagen befinden, selten<br />
gehört werden … Daher hat der Sozialwissenschaftler aus<br />
erkenntnistheoretischen Gründen ein Interesse daran, die Diskussion über<br />
moralische und politische Themen in seiner eigenen Gesellschaft zu<br />
vertiefen und dabei sicher zu stellen, dass diejenigen in der Gesellschaft,<br />
welche Gründe dafür haben mögen, sich gegenüber den vorherrschenden<br />
Hypothesen kritisch zu verhalten, die Gelegenheit finden, ihre alternativen<br />
Begriffsschemata und die ´Tatsachen` zu präsentieren, die von diesen<br />
herausgehoben werden.“ 129<br />
Auf welche Werte stützt sich dieses Interesse? Eine Art Maßstabsproblem einer<br />
kritischen Theorie. Überlegungen wie die referierten weisen noch nicht die<br />
ganze ideologiekritische Schärfe auf, welche für spätere Arbeiten aus der<br />
Frauenbewegung, nicht zuletzt auch für die Arbeiten von Sandra Harding<br />
charakteristisch sind. Ihre Schrift zur „Feministische(n) Wissenschaftstheorie“<br />
sowie ein Aufsatz von Mary E. Hawkesworth sind vorzüglich geeignet,<br />
wesentliche Stellungen des Gedankens zur Objektivität sowie Argumente<br />
zusammenzufassen, welche gegen die eine oder die andere daran anschließender<br />
Varianten aufgeboten werden. 130<br />
Das Kernproblem einer feministischen Wissenschaftstheorie fasst Evelyn Fox<br />
Keller in Form einer Frage zusammen:<br />
„Besteht ein Konflikt zwischen unserem Bekenntnis zum Feminismus und<br />
unseren Verpflichtungen als Wissenschaftlerinnen.“ 131<br />
Diese Frage berührt natürlich unmittelbar das Problem der „Objektivität“ von<br />
Aussagen und Aussagensystemen – und das heißt: nicht zuletzt der jeweils<br />
eigenen! So stellt eine Variante der feministischen Wissenschaftskritik an der<br />
Biologie nach Sandra Harding oftmals „das gesamte methodologische Ethos von<br />
Objektivität, Wertfreiheit, leidenschaftsloser Forschung usw. in Frage, behauptet<br />
aber zugleich, objektive, wertfreie und leidenschaftslose Tatsachen über Natur<br />
und Gesellschaft vorzubringen.“ 132 Es gibt also auch im feministischen Diskurs<br />
ein Wissenschaftsverständnis, das mit Annahmen wie der (a) arbeitet, es gäbe<br />
129 Ebd.<br />
130 Vgl. S. Harding: Feministische Wissenschaftstheorie. Zum Verhältnis von Wissenschaft und sozialem<br />
Geschlecht, Hamburg 1990 und Mary E. Hawkesworth: From Objectivity to Objectification: Feminist<br />
Objections, in: A. Megill: Rethinking Objectivity, Durham and London 1994, S. 151 ff. Vgl. Auch E. Fox<br />
Keller. Feminismus und Wissenschaft, in: E. List und H. Studer (Hrsg.): Denkverhältnisse. Feminismus und<br />
Kritik, Frankfurt/M 1989, S. 281 ff.<br />
131 E. Fox Keller: Feminismus und Wissenschaft, a.a.O.; S. 281.<br />
132 S. Harding: Feministische Wissenschaftstheorie, a.a.O.; S. 107 f.<br />
56