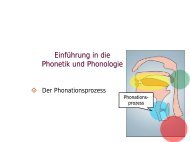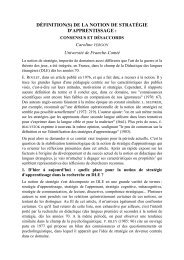Hand und Auge
Hand und Auge
Hand und Auge
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10<br />
<strong>Hand</strong> bzw. das Konzept HAND). 1<br />
Hegel führt ebenso wie für die <strong>Hand</strong> auch für das <strong>Auge</strong> eine von der<br />
Wahrnehmung bzw. von der Tun-Funktion unterscheidbare Ausdrucksfunktion<br />
an. In seiner Enzyklopädie der Wissenschaften, Bd. III, verweist<br />
er auf die <strong>Auge</strong>n als Ort, “an welchem sich die Seele auf die einfachste<br />
Weise offenbart, da der Ausdruck des <strong>Auge</strong>s das flüchtige, gleichsam<br />
eingehauchte Gemälde der Seele darstellt.” (Hegel, 1986, Bd. X: 115).<br />
Die besondere Bedeutung des eigenen Körpers in der Erfahrung von<br />
Welt hat Husserl in den "Cartesianischen Untersuchungen" hervorgehoben:<br />
"Unter den eigenheitlich gefaßten Körpern dieser Natur finde ich dann<br />
in einziger Auszeichnung m e i n e n L e i b , nämlich als<br />
den einzigen, der nicht bloß Körper ist, sondern eben Leib, das einzige<br />
Objekt innerhalb meiner abstraktiven Weltgeschichte, dem ich erfahrungsgemäß<br />
Empfindungsfelder zurechne, obschon in verschiedenen Zugehörigkeitsweisen<br />
(Tastempfindungsfeld, Wärme-Kälte-Feld, usw.), das<br />
einzige in dem ich unmittelbar schalte <strong>und</strong> walte <strong>und</strong> in Sonderheit walte<br />
in jedem seiner Organe . Ich nehme mit den Händen kinästhetisch tastend,<br />
mit den <strong>Auge</strong>n ebenso sehend usw. wahr <strong>und</strong> kann jederzeit so<br />
wahrnehmen, wobei diese Kinästhesen der Organe im Ich tue verlaufen<br />
<strong>und</strong> meinem Ich kann unterstehen; ..." (Husserl, 1950: 128) 2<br />
Ich werde im folgenden erstens gr<strong>und</strong>sätzliche Fragen der Repräsentation,<br />
besonders im Kontext des Zeichengebrauchs (Semiotik) <strong>und</strong> des<br />
Sprachsystems (Grammatik) behandeln <strong>und</strong> vor dem Hintergr<strong>und</strong> der<br />
Kritik aktueller Theorien eine neue, dynamische Konzeption entwickeln<br />
(Kap. 1-4), zweitens werden die Begriffe/Konzepte HAND <strong>und</strong> AUGE<br />
hauptsächlich in drei Sprachen untersucht, <strong>und</strong> es werden exemplarisch<br />
empirische Annäherungen an eine Lösung des Problems der Repräsentation<br />
dargestellt (die Pilotstudien in Kap. 5 <strong>und</strong> 6).<br />
1 Im folgenden markiert die Großschreibung (HAND, AUGE, ....) das Konzept,<br />
d.h. den semasiologischen Aspekt. Dabei werden mehrere sprachspezifische<br />
Ausprägungen zusammengefaßt, z.B. AUGE = ‚<strong>Auge</strong>‘, ‚eye‘, ‚oeil‘.<br />
2<br />
Auf diese Passage bei Husserl hat mich Prof. Gerhard Pasternack hingewiesen.