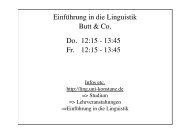Eine computerlinguistische Untersuchung des Genitivschwundes
Eine computerlinguistische Untersuchung des Genitivschwundes
Eine computerlinguistische Untersuchung des Genitivschwundes
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5. Ergebnisse der <strong>computerlinguistische</strong>n Analyse<br />
Tabelle 5 dient dazu, alle Genitivtypen und ihre relativen Häufigkeiten miteinander zu<br />
vergleichen. Zunächst fällt auf, dass alle Genitive zusammen bei Goethe bezogen auf<br />
die gesamte Wortanzahl 1,73 % ausmachen, bei Mann 3,31 % und bei Timm nur noch<br />
0,70 %. Von 1828 bis 1993 ist somit der Genitivschwund deutlich erkennbar, die Prozentzahl<br />
<strong>des</strong> Auftretens <strong>des</strong> Genitivs fällt weit unter 1 %. Der Genitivanteil im gesamten<br />
Text ist bei Mann fast doppelt so hoch wie bei Goethe, obwohl „Der Tod in Venedig“<br />
fast hundert Jahre später als „Novelle“ erschien. Deshalb wird an der Ansicht<br />
festgehalten, dass Thomas Mann in dieser Novelle einen exzessiven Gebrauch <strong>des</strong><br />
Genitivs aufweist. Betrachtet man den höheren Gebrauch an freien Genitiven, den er<br />
im Vergleich zu beiden anderen Autoren aufweist, wird dies umso deutlicher. Der freie<br />
Genitiv, der prädikativ oder adverbial verwendet wird, muss wie der Name schon sagt,<br />
nicht zwingend benutzt werden (siehe Lipavic Ostir, 2010). Thomas Mann neigt also in<br />
„Der Tod in Venedig“ dazu, öfters Genitiv anzuwenden, als tatsächlich verlangt wird. Im<br />
Übrigen ist der freie Genitiv relativ stabil geblieben und wird bei Timm beinahe noch<br />
gleich häufig verwendet wie bei Goethe. Ein homogenes Muster lässt sich auch bei<br />
den durch Präpositionen ausgelösten Genitiven erkennen, außer dass die Prozentzahl<br />
bei Timm im Vergleich zu Goethe nicht abnimmt.<br />
Beim adnominalen Genitiv, der den größten Anteil der Genitive ausmacht, ist eine<br />
ähnliche Verteilung wie in der Gesamtzahl zu erkennen. Wie bereits erwähnt, geht von<br />
Goethe bis Timm die Anzahl der adnominalen Genitive um circa die Hälfte zurück,<br />
während sie zu Mann um fast das Doppelte zunimmt. Bei Adjektiven, die einen Genitiv<br />
zu sich nehmen, ist allerdings schon bei Mann ein deutlicher Schwund von 0,04 % bis<br />
hin zu 0 % 13 zu erkennen. Auch bei Timm kommt keines dieser Adjektive mehr vor.<br />
Diese Genitivart scheint im Laufe der Zeit vollends verschwunden zu sein. Der adverbale<br />
Genitiv hat im modernen Text nur noch eine Erscheinungswahrscheinlichkeit<br />
von 0,02 % und tritt dort lediglich einmal auf. Dem steht jedoch gegenüber, dass sich<br />
von Goethe diese Wahrscheinlichkeit von 0,04 % bis hin zu Mann mit 0,09 % mehr als<br />
verdoppelt. Dies deutet daraufhin, dass bereits bei Goethe der adverbale Genitiv nur<br />
sehr selten vorkam, Mann sich aber durch <strong>des</strong>sen vermehrte Verwendung auszeichnet.<br />
Im heutigen Sprachgebrauch wird der adverbale Genitiv so gut wie nicht<br />
mehr verwendet, was durch den fast vollständigen Schwund dieser Konstruktionen in<br />
„Die Entdeckung der Currywurst“ aufgezeigt werden kann. Konjunktionen, Adverbien<br />
und Adjektive, die Genitiv enthalten sind ebenfalls sehr stark zurückgegangen. Zudem<br />
ist hier ein Rückgang über Mann deutlich zu erkennen. Vermutlich sind diese Konjunktionen,<br />
Adverbien oder Adjektive zum Großteil veraltet und kommen <strong>des</strong>halb im<br />
modernen Sprachgebrauch immer seltener vor.<br />
13 bei einer relativen Frequenz von 0,000040<br />
46