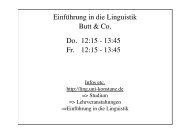Eine computerlinguistische Untersuchung des Genitivschwundes
Eine computerlinguistische Untersuchung des Genitivschwundes
Eine computerlinguistische Untersuchung des Genitivschwundes
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6. Diskussion<br />
die Eindeutigkeit der Funde bei Goethe kann nicht bewiesen werden und auch die<br />
konkurrierenden Fälle geben keinen Aufschluss hierüber.<br />
Bezieht man sich, bei näherer Betrachtung der adverbalen Genitive, auf die in der<br />
Auswertung beschriebene Konkurrenzsituation, so sollte man beachten, dass über den<br />
Partivitätseffekt und den Verlust der Aspektkategorie hier nicht mehr zu argumentieren<br />
ist. Denn wie im Abschnitt über die Ursachen für den Genitivschwund im zweiten<br />
Kapitel bereits aufgeführt wurde, fanden diese Phänomene bereits in der althochdeutschen<br />
beziehungsweise mittelhochdeutschen Zeit statt. Allerdings könnte die<br />
sekundäre Begleiterscheinung <strong>des</strong>sen – der Rückzug einiger adverbalen Genitive in<br />
bestimmte gehobene Stilschichten – für die unterschiedliche Benutzung der Verben<br />
verantwortlich sein. Die adverbalen Genitive bei Goethe sind alle eindeutig und auch<br />
der einzige adverbale Genitiv, der bei Timm gefunden wurde, kann als solcher gewertet<br />
werden, denn Hentschel (2010a) führt den Genitiv als Objekttyp <strong>des</strong> Verbs<br />
bedürfen auf. Auch die vielen adverbalen Genitive, die in „Der Tod in Venedig“ identifiziert<br />
wurden, sind zum Großteil eindeutig und bei den nicht-eindeutigen Fällen gibt es<br />
wenig Zweifel daran, dass diese eigentlich ein konkurrieren<strong>des</strong> Objekt darstellen.<br />
Auffällig ist, dass sich erinnern in Verbindung mit Genitiv steht, während erinnern mit<br />
Präpositionalobjekt erscheint. Bei Goethe hingegen kam sich erinnern bereits in<br />
konkurrierenden Konstruktionen vor. Betrachtet man sich erinnern bei Mann näher, so<br />
wird deutlich, dass im Gegensatz zu erinnern, sich erinnern mit Genitiv dann verwendet<br />
wird, wenn von den persönlichen positiven Erinnerungen Aschenbachs die Rede ist.<br />
Wird von negativen Erinnerungen gesprochen, so kommt erinnern mit Dativ zum<br />
Einsatz (siehe Mann, 1912). Die Verben stehen also in Konkurrenz und ferner in einer<br />
anderen Verteilung als zuvor, um als Stilmittel zu dienen und positive Empfindungen<br />
auf eine höhere Stilebene zu heben. In der modernsten untersuchten Novelle kommt<br />
erinnern sowohl reflexiv als auch nicht-reflexiv nur in konkurrierenden Formen zum<br />
Genitiv vor. Beim Verb schonen, welches in „Novelle“ sowohl mit Genitiv als auch Akkusativ<br />
auftritt, ist der Sprecherbezug nicht ganz deutlich. Man kann aber feststellen,<br />
dass die Wärterin und der Honorio lediglich Akkusativ benutzen, während das einzige<br />
Genitivvorkommen in Abhängigkeit von schonen nur beim Fürsten in einem Konditionalsatz<br />
zu finden ist (siehe Goethe, 1828). Dies deutet auch auf den Genitiv als<br />
Stilmittel für die gehobene Sprache <strong>des</strong> Fürsten hin, was allerdings durch die<br />
zusätzliche Benutzung <strong>des</strong>selben Verbs mit Akkusativ vom Fürsten abgeschwächt<br />
wird.<br />
Hinsichtlich der Frequenzen <strong>des</strong> adverbalen Genitivs wird deutlich, dass dieser heutzutage<br />
kaum noch verwendet wird, weil er von Goethe zu Timm bis auf 0 % sinkt. Da<br />
59