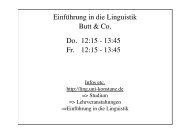Eine computerlinguistische Untersuchung des Genitivschwundes
Eine computerlinguistische Untersuchung des Genitivschwundes
Eine computerlinguistische Untersuchung des Genitivschwundes
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6. Diskussion<br />
unerhörte Begebenheit, die Rahmenerzählung und das Gespräch sind eindeutig vorhanden.<br />
Der abweichende Novellencharakter bei Mann könnte verantwortlich dafür sein, dass<br />
der Autor fast in jeder Kategorie deutlich mehr Genitive benutzt als die anderen, da er<br />
weniger nah an der Alltagssprache und näher an der gehobenen Sprache schreibt.<br />
Dies sei jedoch dahingestellt, denn die Novellenauszeichnung seines Werks stammt<br />
von ihm selbst und sein hoher Genitivgebrauch scheint wohl ebenfalls von ihm gewollt.<br />
Zudem kommen bei ihm durchaus umgangssprachliche Konstruktionen vor, denn es<br />
wird häufig die indefinite Lesart von welche gefunden, die als umgangssprachlich gilt<br />
(siehe Meinunger, 2008).<br />
Der Bezug zur Neuklassik, der in allen drei Novellen vorzufinden ist, ist bei Thomas<br />
Mann am stärksten. Nicht nur die häufigen Bezugsnahmen zu griechischen Göttern<br />
und Helden sowie Philosophen sind auffällig, sondern auch sein Schreibstil ist in dieser<br />
Hinsicht als neuklassizistisch zu deuten. Vor allem im 18. und 19. Jahrhundert waren<br />
Griechisch und Latein sehr angesehen und griechische Schreibweisen wurden adaptiert<br />
(siehe Meinunger, 2008). So erscheint bei Mann das Wort Stil in „Meisterhaltung<br />
NN unseres PPOSAT Styls NN“ (ven-output.txt: Z.592) in einer dem Griechischen<br />
nahegelegten Schreibweise. Die hier besprochene Novelle von Thomas Mann erschien<br />
zwar erst im 20. Jahrhundert, dennoch wird deutlich, dass er sich gerne an veralteten<br />
Normen orientiert. Dieser Rückbezug zur Antike könnte auch maßgeblich für seinen<br />
hohen Genitivgebrauch sein. Bei Goethe ist ein derartiger Bezug zur Antike oder zum<br />
Klassizismus nur in den lyrischen Abschnitten seiner Novelle zu erkennen, jedoch<br />
entstand „Novelle“ im Zeitrahmen der Klassik (siehe Aust, 2012). Bei Timm kann eine<br />
neuklassische Deutung nur auf interpretatorischer Ebene stattfinden.<br />
Thomas Mann wird häufig an deutschen Schulen unterrichtet mit dem Zweck, den<br />
Schülern seinen Stil näher zu bringen (siehe Kurzke, 2009). Es ist allerdings Goethe,<br />
der größte deutsche Dichter, der als Instanz der Normierer gewertet wird, womit vor<br />
allem die Vertreter <strong>des</strong> Dudens gemeint sind (siehe Meinunger, 2008). Somit ist gerechtfertigt,<br />
Goethe als standarddeutschen Referenztext einzustufen und Mann, da<br />
seine Novelle zeitlich später erschien, als von der Norm abweichend beziehungsweise<br />
diese übertreibend zu interpretieren. Es fand also kein Anstieg im Genitivgebrauch<br />
statt, bevor ein deutlicher Schwund auftrat.<br />
Abschließend kann ein deutlicher Genitivschwund innerhalb der letzten beiden Jahrhunderte<br />
mit Hilfe <strong>des</strong> erstellten Perlskripts gezeigt werden. Die Ergebnisse machen<br />
deutlich, dass der Gebrauch <strong>des</strong> Genitivs insgesamt von Goethe zu Timm zurückging,<br />
64