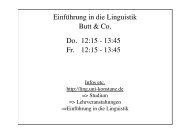Eine computerlinguistische Untersuchung des Genitivschwundes
Eine computerlinguistische Untersuchung des Genitivschwundes
Eine computerlinguistische Untersuchung des Genitivschwundes
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6. Diskussion<br />
Ein interessanter Fall, der bereits im vorherigen Kapitel erwähnt wird, ist unter den<br />
freien Genitiven zu finden. Dort wird davon ausgegangen, dass dieser Genitivtyp stabil<br />
bleibt, sich jedoch in seiner Form stark verändert. Aber gerade diese Änderung ist erstaunlich:<br />
Während sich in den anderen beiden Novellen noch vielfältige freie Genitive<br />
finden lassen, so tauchen in der modernen Novelle nur noch Formen auf, die sich aus<br />
einem unbestimmten Artikel und einer Form der Tageszeit zusammensetzen. Wie<br />
bereits erwähnt, sticht hier „<strong>Eine</strong>s PIS Nachts ADV“ (cur-output.txt: Z.555) heraus, da<br />
das weibliche Nomen Nacht als männlicher Genitiv verwendet wird. In dieser Gruppe<br />
kommen folglich nur noch feststehende Wendungen vor und es werden auch genau<br />
diese nachgeahmt, denn freie Genitive, vor allem adverbiale, sind heutzutage nicht<br />
mehr produktiv (siehe Lipavic Ostir, 2010). Aus diesem Grund ist anzunehmen, dass<br />
innerhalb dieses Genitivtyps ein deutlicher Schwund stattfand und im Gegenteil zur<br />
ursprünglichen Vermutung keinesfalls von der Stabilität <strong>des</strong> freien Genitivs ausgegangen<br />
werden kann.<br />
Ein weiterer Problemfall wird von den Prä- und Postpositionen, die Genitiv übertragen,<br />
verdeutlicht. Oftmals ist nicht klar, ob es sich beim Attribut der Prä- oder Postposition<br />
tatsächlich um einen Genitiv handelt. Bereits die beiden Vorkommnisse, die bei Goethe<br />
gefunden wurden, lassen hierbei Zweifel aufkommen. Aufgrund der Ambiguität <strong>des</strong><br />
Artikels der kann nicht eindeutig unterschieden werden, ob ein Genitiv oder ein Dativ<br />
auftaucht. Konsultiert man dazu die Experten vom Duden 14 , wird schnell deutlich, dass<br />
die Präposition anstatt vorrangig mit Genitiv auftritt und an dieser Stelle richtig erkannt<br />
wird. Auch die Konstruktion mit wegen kann als Genitiv interpretiert werden, eine<br />
dativische Interpretation wäre als umgangssprachlich zu werten. Derartige Konstruktionen<br />
lassen sich zudem bei Mann finden, können aber nach Konsultation <strong>des</strong> Dudens<br />
ebenfalls als Genitive gezählt werden. <strong>Eine</strong> interessante Konstruktion bei Mann, die<br />
wiederum bei Timm dreimal auftaucht, ist jene, die aus voller und einem nachfolgenden<br />
Nomen ohne Artikel besteht. Wie kann man sich hier sicher sein, dass es sich um<br />
einen Genitiv handelt? Der Duden gibt an, dass die Präposition voller nur in seltenen<br />
Fällen gemeinsam mit Dativ auftritt, weshalb die genitivische Lesart bevorzugt werden<br />
sollte. Weiterhin fallen bei Timm mehrere Konstruktionen mit wegen auf, bei denen<br />
unklar ist, ob Dativ oder Genitiv gebraucht wurde.<br />
Geht man davon aus, dass es sich bei Novellen um Textformen handelt, die wegen<br />
ihres gesprächshaften Charakters nahe an der gesprochenen Sprache liegen, so<br />
könnte man durchaus behaupten, dass die gefundenen Problemfälle von dativischer<br />
Natur sind. Zudem könnte man postulieren, dass eine Umkehr von Genitiv zu Dativ<br />
14 Erscheint der Begriff Duden, wird stets auf Duden online (2013) zurückgegriffen.<br />
57