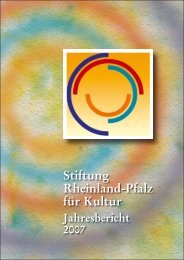Broschüre Satz für Internet.indd - Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur
Broschüre Satz für Internet.indd - Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur
Broschüre Satz für Internet.indd - Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der „Eiserne Garten“ zu Schloss Malberg<br />
Verbandsgemeinde Kyllburg<br />
Schloss Malberg in der Kyllburger Waldeifel liegt auf einem lang gestreckten Bergrücken, der von der Kyll<br />
umflossen wird. Die frühere Burganlage bestand aus zwei dicht nebeneinander liegenden Burgen, die im<br />
Laufe des Mittelalters im Besitz verschiedener Familien waren. 1678 erwarben die Brüder Johann Christoph<br />
von Veyder und Johann Werner von Veyder, damals Weihbischof von Köln, die gesamte Herrschaft<br />
Malberg. Das heutige Schloss (das so genannte Neue Haus) wurde in den Jahren 1707–1715 von Johann<br />
Werner von Veyder auf dem Areal der mittelalterlichen Burganlage errichtet. Von der einstigen Burg ist<br />
bis heute noch der Altbau erhalten (das so genannte Alte Haus). Die barocke Schlossanlage entstammt<br />
den Plänen des kurpfälzischen Hofarchitekten Graf Matteo Alberti (1647/48–1735) aus Venedig, der in<br />
Düsseldorf tätig war. Er ließ sich bei der Gestaltung des Neuen Hauses stark von der Villa Valmarana in<br />
Lisiera (Veneto) des italienischen Architekten Andrea Palladio (1563) beeinflussen. Schloss Malberg ist<br />
damit eines der wenigen Zeugnisse palladianischen Baustils in Deutschland. Seit 1990 ist das Anwesen<br />
im Besitz der Verbandsgemeinde Kyllburg.<br />
Die Gärten auf Schloss Malberg wurden im Zuge des Schlossumbaus in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts<br />
angelegt. Während der nach seiner ehemaligen schmiedeeisernen Umfriedung „Eiserne Garten” genannte<br />
rechteckige Garten an der Schlosszufahrt um 1713 im Zusammenhang mit den barocken Neubauten<br />
angelegt wurde, entstand der nach seinem halbkreisförmigen Grundriss benannte „Runde Garten” erst um<br />
1730 im Auftrag von Franz Moritz von Veyder. Durch die zurückgezogene Lage des Landschaftsraumes der<br />
Eifel haben sich die Gärten in den drei zurückliegenden Jahrhunderten in ihrer barocken Grundstruktur<br />
kaum verändert und sind bis heute gut erhalten.<br />
Die Erstanlage des Eisernen Gartens folgte dem Stil des italienischen Villengartens der Spätrenaissance.<br />
Das Hauptwegekreuz wurde in der Mitte zumeist mit einem Zierbrunnen in Kleeblattform oder Varianten<br />
dieser Form betont. Die rechteckigen Beete werden als Kompartimente bezeichnet und waren mit niedrigen<br />
Buchs- oder auch Lavendelhecken eingefasst. Als Bepflanzung wurden blühende und wohlriechende<br />
Pflanzen, wie Lavendel, Vergissmeinicht, Rosen und viele andere, verwendet.<br />
Die Einteilung in vier Kompartimente und der Brunnen zur Betonung des Wegekreuzes prägen noch heute<br />
den Garten am Standort der früheren Unterburg. Aus den Handwerkerrechnungen geht hervor, dass 1713<br />
Meister Maßem das Mauerwerk „der kleiner Maur im garten worauf die pilaren [Pfeiler]” stehen, errichtet<br />
hat, und im Jahr 1714 hat wieder „Meister Mahsem Undt Conhorten Meürer: Die garten Maur Und Somer<br />
Haußgen [Sommerhäuschen, Standort ist unbekannt] … Denen bronnen behalter [Brunnenbehälter] im<br />
garten zu machen und die Belaren [Pfeiler] auf zurichten, wie auch Eine Sug [Entwässerungsgerinne]<br />
zum abläuf machen…” Die erwähnte kleine Mauer mit acht Pfeilern aus rotem Sandstein ist noch heute<br />
vorhanden, und das ornamentreiche schmiedeeiserne Tor erläutert sichtbar den Namen des Gartens.<br />
Der geometrische Grundriss des Gartens lässt den Schluss zu, dass er gemäß dem Vorbild frühklösterlicher<br />
Gärten als Nutzgarten angelegt wurde. Üblicherweise wurden dort Gemüse, Heilpflanzen und Stauden<br />
zum eigenen Verbrauch angezogen. Während Gemüse und Heilkräuter in der Küche Verwendung fanden,<br />
dienten die Stauden nicht nur der Zierde des Gartens, sondern lieferten zugleich den Blumenschmuck<br />
<strong>für</strong> das Schloss. Durch die Verbindung von Schönem mit dem Nützlichen boten diese Gärten dem Betrachter<br />
ein angenehmes Bild. Noch reizvoller wurde der Aufenthalt im Garten durch die Verwendung<br />
wohlriechender Kräuter, die als Heilpflanzen oder Küchengewürze Verwendung fanden. Interessanterweise<br />
sind auch genau <strong>für</strong> diesen Zeitraum enge Beziehungen zu dem in direkter Nähe liegenden klösterlichen<br />
Garten des Zisterzienserinnenklosters St. Thomas nachweisbar. Im Südosten Richtung Altbau liegt leicht<br />
erhöht eine Terrasse mit alten Obststräuchern und Blumenschmuck. Besonders sehenswert sind sehr<br />
alte dunkelrote Pfingstrosen, die in einer Reihe oberhalb der Mauer gepflanzt wurden und im Juni ein<br />
prachtvolles Bild bieten. Dahinter erhebt sich eine steile Böschung, die zum oberen Schlosshof führt.<br />
Ganz versteckt liegt in der Ecke zwischen Brüstungsmauer und Treppe zum Schlosshof der Nebeneingang<br />
zum Eisernen Garten, der ebenfalls mit einem prächtigen schmiedeeisernen Tor geziert wird. Die Abgeschlossenheit<br />
des Gartens trägt die charakteristischen Züge eines geschützten Raumes, auch „hortus<br />
conclusus” genannt, in dem man ungestört Ruhe fand.<br />
44